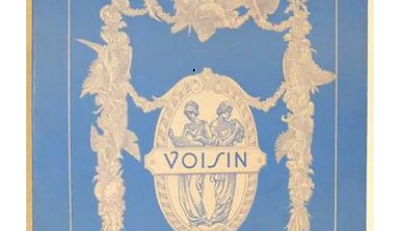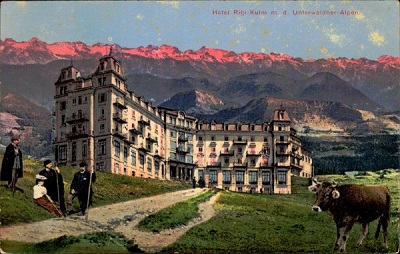Wie der "Nerd" Frauen vom Informatik-Studium abhält - Expertise für die Bundesregierung zu Frauen in MINT

Der Ulmer Gastprofessor für Geschlechterforschung, Dr. Yves Jeanrenaud,
hat eine Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung verfasst. Er befasst sich darin mit der Frage, warum
Frauen im MINT-Bereich noch immer unterrepräsentiert sind. Im Fokus stehen
dabei kulturelle und strukturelle Barrieren wie MINT-bezogene
Geschlechter-Stereotype sowie Rollen- und Berufsbilder. Die Expertise
floss in das Gutachten der Sachverständigenkommission ein, das am 26.
Januar der Bundesgleichstellungsministeri
wird.
Das Klischee vom „Nerd“ ist weit verbreitet, nicht zuletzt aufgrund seiner
fortwährenden medialen Reproduktion. Was viele allerdings nicht wissen:
das Bild vom männlichen Computer-Freak hält Frauen vom Informatik-Studium
ab. Zu dieser Einschätzung kommt Dr. Yves Jeanrenaud. Der Gastprofessor
für Geschlechterforschung in MINT & Med. an der Universität Ulm hat in
einer rund fünfzigseitigen Studie herausgearbeitet, welche kulturellen und
strukturellen Faktoren Frauen davon abhalten können, ein MINT-Studium
aufzunehmen. In dieser allgemeinverständlichen Expertise zum Gutachten für
den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung präsentiert er
zudem einen Überblick über bestehende Fördermaßnahmen und gibt weitere
Handlungsempfehlungen, wie der Frauenanteil im MINT-Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) langfristig gesteigert werden
kann.
Denn noch immer ist der Frauenanteil unter den MINT-Studierenden in
Deutschland mit etwa einem Drittel im internationalen Vergleich recht
niedrig. Noch vielsagender ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten in
MINT-Berufen: er beträgt gerade einmal ein Sechstel. Und das obwohl im
Zuge der Digitalisierung die Berufsaussichten und Karrierechancen
insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
besser sind denn je. Doch was haben Stereotypen, Rollen- und Berufsbilder
mit Studien- und Berufsentscheidungen zu tun? „Berufsbilder wie Ingenieur
oder Informatiker sind noch immer männlich konnotiert. Insbesondere
klischeehafte Rollenbilder wie die des Nerds werden so gut wie
ausschließlich für junge Männer gebraucht. Viele Frauen fürchten sich
davor, von ihrer `Weiblichkeit´ einzubüßen, wenn sie sich auf dieses
männlich besetzte Terrain vorwagen. Sie entscheiden sich dann nicht selten
gegen ein Informatik-Studium, obwohl sie ein gewisses Interesse dafür
durchaus mitbringen“, erklärt Dr. Yves Jeanrenaud.
Warum ist das so? Von Kindesbeinen an macht der Mensch
geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen und internalisiert damit
bestimmte Erwartungen, die an sein Geschlecht gebunden sind. „Passt die
verinnerlichte Geschlechterrolle nicht zum geläufigen Berufsbild oder
einer bestimmten Fächerkultur, droht die Abkehr. Dies gilt für Männer in
Pflegeberufen genauso wie für Frauen in den Ingenieurwissenschaften oder
Informatik“, so der Soziologe. Einen weiteren Gender-Effekt sieht
Gastprofessor Yves Jeanrenaud im sogenannten MINT-Fähigkeitsselbstkonzept,
das dazu führt, dass Mädchen ihre Leistungen in Mathematik und
Naturwissenschaften ganz anders einschätzen als Jungen, selbst wenn diese
gleich ausgeprägt sind.
Außerdem orientierten sich Mädchen beziehungsweise Frauen bei der
Berufswahl oft noch an bestimmten sozialen Mustern und wünschen sich
berufliche Tätigkeiten, bei denen sie mit anderen Menschen zu tun haben
oder das Gefühl haben, etwas Sinnstiftendes zu tun. Vielen MINT-Berufen
hafte allerdings noch immer das Image der isolierten Beschäftigung mit
Dingen statt mit Menschen an. Dazu kommt, dass viele Schülerinnen und
Schüler nur vage oder gar keine Vorstellungen von vielen Technik-Berufen
haben. Der Ulmer Soziologe hält es dafür für ratsam, die gesellschaftliche
Bedeutung solcher Berufe stärker hervorzuheben und auch zu hinterfragen,
ob nicht vielleicht auch sehr männlich geprägte Fachkulturen oder ein
bestimmter Berufshabitus eine abschreckende Wirkung auf Frauen hat.
Der Gender-Forscher betont in diesem Zusammenhang die Rolle von
„Gatekeepern“ wie Eltern und Lehrkräften, die einen großen Einfluss darauf
haben, welchen Weg die Kinder später einmal beruflich einschlagen werden.
Wichtig sind auch positive Rollenmodellen, die Mädchen darin bestärken,
MINT-Interessen zu entwickeln und selbstbewusst nachzugehen. Immerhin
steigen die Frauenanteile in MINT-Studiengängen und -berufen dank
umfangreicher Fördermaßnahmen von Seiten der Politik, der Wirtschaft und
der Bildungsträger kontinuierlich an, doch bleiben die Zahlen teils noch
immer weit unter den Erwartungen. So gibt es zwar im Studien-Fach
Mathematik ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, doch dies liegt
wahrscheinlich am hohen Anteil der Lehramtsstudentinnen in diesem Fach.
Ein ähnlicher Effekt lässt sich in den Naturwissenschaften beobachten, wo
ebenfalls dank entsprechender Lehramtsstudiengänge die Zahl weiblicher
Studierender so gut wie ausgeglichen ist. In den Technik-Fächern sieht
dies mit einem Frauenanteil von 26,3 Prozent schon wieder ganz anders aus.
Das Schlusslicht macht hier die Informatik mit einem Anteil an weiblichen
Studierenden von 22 Prozent.
„Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr weibliche Vorbilder und positive
Rollenmodelle!“, fordert Jeanrenaud. Das müssen keine nerdy Superheldinnen
sein, wie die schwedische Hackerin Lisbeth Salander, und auch keine Mathe-
Genies. Nach Meinung des MINT-Experten wird Mathematik im Informatik-
Studium mitunter etwas überbetont. „Wir müssen gerade auch die normal
begabten Schülerinnen für ein Informatik- oder Technik-Studium
begeistern“, meint der Gender-Forscher.
Expertise „MINT. Warum nicht? Zur Unterrepräsentation von Frauen in MINT,
speziell IKT, deren Ursachen, Wirksamkeit bestehender Maßnahmen und
Handlungsempfehlungen“ – Kurzlink: https://t1p.de/5xp5
Weitere Informationen zum Dritten Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung finden Sie unter im Internet unter:
https://www.dritter-gleichstel
gleichstellungsbericht.html
Was sind Gleichstellungsberichte?
Hintergrundinformationen zum Verfahren, zu Bestandteilen und Abläufen der
Gleichstellungsberichte finden Sie hier:
https://www.dritter-gleichstel
gleichstellungsberichte.html
Das Gutachten für den Dritten Gleichstellungsbericht wird
Bundesgleichstellungsministeri
übergeben und zeitgleich auf der Homepage veröffentlicht.
- Aufrufe: 1