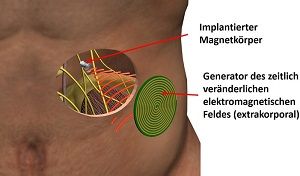Elektrostimulation statt Medikamente: Magnetoceuticals – Ansatz zur elektromagnetischen Stimulation von Nervengewebe
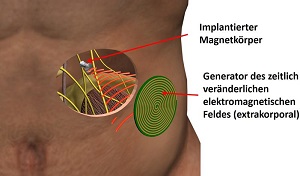
Eine Vielzahl von Erkrankungen werden heute medikamentös behandelt. Dies
ist häufig mit Nebenwirkungen verbunden, die für den ohnehin erkrankten
Menschen gravierend sein können. Ein neuer Therapieansatz, bekannt unter
dem Schlagwort »Bioelektronische Medizin«, sieht die Therapie von
Erkrankungen mittels Elektrostimulation vor. Seit April 2019 bringt das
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT im BMBF-
Verbundprojekt »Magnetoceuticals« seine langjährige Expertise im Bereich
intelligenter miniaturisierter aktiver Implantate ein, um ein neuartiges
Elektrostimulationssystem für Nervengewebe zu entwickeln.
Im BMBF-Verbundprojekt »Magnetoceuticals« entwickelt das Konsortium aus
Forschungs- und Industriepartnern einen neuartigen Ansatz zur Stimulation
von Nervengewebe unter Nutzung elektromagnetischer Felder. Ein extern am
Körper getragenes Elektronikgerät und ein rein passives, stark
miniaturisiertes Implantat ohne eigene Elektronik und Elektrodenkontakte
in Form eines biokompatibel gekapselten Magnetkörpers, sind die
wesentlichen Bestandteile des Systems. Die am Körper getragene Elektronik
strahlt zeitveränderliche magnetische Felder in Richtung des Implantats
ab. Das Implantat konzentriert diese und leitet sie an den Stimulationsort
weiter. Gemäß den Maxwell-Gleichungen resultiert aus dem
zeitveränderlichen Magnetfeld ein zeitveränderliches elektrisches Feld,
das - bei geeigneter Wahl aller Parameter - im zu stimulierenden Gewebe
ein Aktionspotenzial auslöst. Die Stimulation soll so wirksam und
ortsaufgelöst erfolgen, wie das heute bei sehr komplexen Implantaten
bereits der Fall ist. Diese Art der Therapie kommt ohne Medikamente und
ohne eine implantierte Elektronik und Elektroden aus.
Innovation schont Patientinnen und Patienten
Die Innovation im »Magnetoceuticals«-Projekts besteht in der selektiven
Stimulation von Nerven ohne Elektroden und implantierte Elektronik. Dies
erspart Kabelverbindungen zwischen Implantatelektronik und Elektroden und
Probleme wie Kabelbruch oder Elektrodenkorrosion werden vermieden. Da das
Implantat über keinerlei Elektronik verfügt, müssen keine besonderen
Vorkehrungen zum Schutz des Implantats vor Feuchte getroffen werden und
aufgrund des Fehlens einer Implantatbatterie ist die Implantatlebensdauer
praktisch unbegrenzt. Somit entfallen chirurgische Eingriffe für einen
Batteriewechsel komplett. Zudem ist das Implantat aufgrund seines kleinen
und einfachen Aufbaus unkompliziert zu im- und explantieren. Damit werden
nicht zuletzt die Patientinnen und Patienten geschont. Die ohne
Implantatbatterie auskommende und örtlich fokussierte Stimulation eignet
sich besonders für Anwendungen, bei denen eine vorübergehende Stimulation
zur Linderung von Symptomen erwünscht ist, wie beispielsweise zur
Schmerzbehandlung, Senkung von Bluthochdruck, Bekämpfung von Migräne oder
Reduzierung von Fettleibigkeit.
Fraunhofer IBMT-Expertise im Einsatz
Die Schwerpunkte der Arbeiten des Fraunhofer IBMT liegen auf der
Simulation des Gesamtsystems, dem Erarbeiten der Implantatkörper sowie dem
Test der aufgebauten Systeme. Eine Herausforderung besteht darin, für den
zeitlichen Verlauf des externen Magnetfelds und die Geometrie sowie das
Material des Implantatkörpers eine Kombination zu finden, die trotz der
bestehenden Limitationen existierender magnetischer Materialien in Bezug
auf Permeabilität und Sättigungsmagnetisierung zu elektrischen Feldern am
zu stimulierenden Gewebe führen, die Aktionspotenziale auslösen.
Computersimulationen wurden eingesetzt, um eine geeignete
Systemkonfiguration zu finden und die Geometrie des Implantatkörpers zu
optimieren. Nun gilt es, eine Elektronik zu entwickeln, die den nötigen
zeitlichen Verlauf der Magnetfelder gewährleistet. Abschließend soll das
System an Nervengewebe getestet werden.
Neben den bereits erwähnten Vorteilen des elektrodenlosen
Stimulationssystems ergaben die Simulationen interessanterweise einen
weiteren Vorteil hinsichtlich der Anwendersicherheit: Die Geometrie des
Implantatkörpers kann so gestaltet werden, dass der Implantatkörper in die
magnetische Sättigung eintritt, sobald er Magnetfeldern ausgesetzt wird,
die die für die Stimulation erforderliche Stärke überschreiten. Eine
Überstimulation durch extrem starke Magnetfelder kann somit allein durch
das geschickte Design des Implantatkörpers ausgeschlossen werden.
Projektförderung: BMBF 16ES0956 (KMU-innovativ: Elektronik und autonomes
Fahren)
Projektlaufzeit: 04/2019 - 03/2022
Verbundkoordinator:
OSYPKA AG, Rheinfelden (Baden)
Projektpartner:
CORSCIENCE GmbH & Co. KG, Erlangen
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT, Sulzbach
- Aufrufe: 306