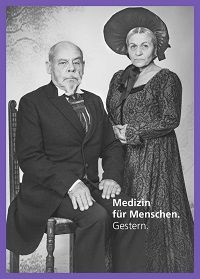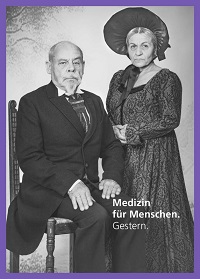Meeresbiologin Antje Boetius spricht an der Leopoldina über die Rolle der Ozeane
Die Ozeane und die Eisvorkommen auf der Erde bedecken einen großen Teil
der Oberfläche unseres Planeten. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass die
Erde bewohnbar ist. Denn Ozeane und Kryosphäre reflektieren das
Sonnenlicht und vermeiden so eine Überhitzung der Erde, sie nehmen CO₂ auf
und sie sind Lebensraum einer unbekannten Vielfalt von Leben, die weit
über die Artenvielfalt an Land hinausgeht. Doch wie intakt ist dieser
Lebensraum noch, welche Spuren haben Klimawandel und Umweltverschmutzung
bereits hinterlassen? Darüber spricht Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin
des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven anlässlich der Leopoldina-
Jahresversammlung am 21. September in Halle (Saale).
Abendvortrag von Prof. Dr. Antje Boetius, Bremerhaven
„Ozeane, Kryosphäre und Mensch: Was uns die fremde Natur bedeutet“
Freitag, 21. September, 20.15 bis 21.15 Uhr
Hauptgebäude der Leopoldina, Festsaal
Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)
Ozeane und Kryosphäre enthalten die größten genetischen Ressourcen der
Erde. Weil Polar- und Tiefseeökosysteme weit entfernt von Land liegen und
für Menschen dort extreme Bedingungen herrschen, sind sie jedoch schwer
zugänglich und deswegen größtenteils unbekannt. Es ist schwierig zu
bewerten, welche Auswirkungen die Lebensweise des Menschen auf diese
Ökosysteme hat. Jedoch gibt es mittlerweile erhebliche Beweise für den
menschlichen Fußabdruck in den fernsten Regionen der Erde: Nachweisbar
sind Auswirkungen des Klimawandels, die Verschmutzung, insbesondere mit
Plastik, und die Ausbeutung von Ressourcen im Meer und in der Kryosphäre.
Antje Boetius fasst in ihrem Vortrag jüngste Beobachtungen der
Veränderungen von Polar- und Tiefseeökosystemen zusammen und spricht über
Strategien zum Schutz der unbekannten Natur als Teil einer nachhaltigen
Entwicklung. Sie wird zudem benennen, welche Rolle Nationalakademien in
dieser politischen Debatte haben, um Handlungsoptionen aufzuzeigen und
Maßnahmen zum Schutz von Ozeanen und Kryosphäre anzustoßen.
Die Meeresforscherin und Mikrobiologin Antje Boetius ist Direktorin des
Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
Bremerhaven, und seit 2009 Mitglied der Leopoldina. Sie erforscht
Mikroorganismen, die Teile des Meeresbodens besiedeln und großen Einfluss
auf das globale Klima haben. Für ihre Forschungen und für ihr Engagement
in der öffentlichen Vermittlung von Wissenschaft wurde sie 2018 mit dem
Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet und
erhält Ende Oktober den Deutschen Umweltpreis.
- Aufrufe: 20