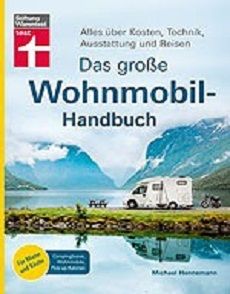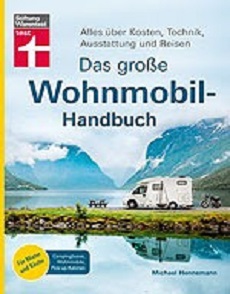Das Elektroauto laden, wenn „grüner“ Strom fließt: Forschungsteam der Hochschule Osnabrück entwickelt CO2-Kompass
Software veranschaulicht, woher der eingespeiste Strom zu einem bestimmten
Zeitpunkt stammt. Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung fördert das Projekt
mit mehr als 140.000 Euro
Die Nachfrage wächst: Am 1. Januar 2020 betrug der Bestand an Elektroautos
auf deutschen Straßen laut Kraftfahrt-Bundesamt mehr als 136.600
Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von mehr als 53.000.
Zugleich haben zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer nach einer Studie des
Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt den Wunsch, Elektrofahrzeuge zu jenen Zeitpunkten zu laden, an
denen der Strom vor allem aus erneuerbaren Quellen generiert wird.
Auch vor diesem Hintergrund hat ein Forschungsteam der Hochschule
Osnabrück den CO2-Kompass entwickelt. Die web-basierte Plattform macht für
Kundinnen und Kunden transparent, woher der eingespeiste Strom stammt. In
einem nächsten Schritt soll die Software unter anderem in eine „Smarte
Ladesäule“ integriert werden. Sie ist in der Lage, bevorzugt dann zu
laden, wenn CO2-armer, „grüner“ Strom fließt. Die Aloys & Brigitte
Coppenrath Stiftung fördert das Projekt mit mehr als 140.000 Euro.
„Wir haben eine Software entwickelt, die die Zusammensetzung der
Stromerzeugung transparent macht, zu welchen Anteilen der Strom also zu
einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel aus Solarkraft, Windkraft oder
Atomkraft stammt“, erläutert Projektleiter Prof. Dr. Hans-Jürgen
Pfisterer. „Damit einher geht die Berechnung der CO2-Emissionen, für die
das System täglich um 0 Uhr auch eine Prognose für die nächsten 24 Stunden
erstellt.“
Der CO2-Kompass basiert auf einer Schnittstelle zwischen der Datenbank des
Verbandes Europäischer Übertragungsnetzbetreiber und der Datenbank des
CO2-Kompasses. „In unserer Datenbank werden die Stromproduktionsdaten für
jeden der bundesweit vier Netzbetreiber und für Deutschland im Gesamten
gespeichert“, erläutert der Doktorand Lucas Hüer. In fünfminütigen
Abständen werden die Rohdaten übermittelt. Im nächsten Schritt folgt eine
Berechnung der CO2-Werte auf Grundlage der Produktionszahlen. Eine
sogenannte REST-Schnittstelle ermöglicht es schließlich, die Emissions-
Informationen mit elektrischen Geräten zu koppeln.
„So ist beispielsweise die Verbindung des CO2-Kompasses mit einer
intelligenten Ladesäule möglich. Sie erfragt über die Schnittstelle
kontinuierlich den aktuellen Strommix inklusive zugehöriger
Emissionswerte“, erläutert Pfisterer. „Dementsprechend können die
Ladevorgänge zeitlich angepasst werden.“ Auch eine Verknüpfung mit anderer
Hardware, etwa Haushaltsgeräten, Wärmepumpen oder Klimaanlagen, ist
möglich.
„Und natürlich lässt sich der CO2-Kompass grundsätzlich zur Visualisierung
nutzen“, sagt Pfisterer. „Man kann sich auf einer Webseite mit wenigen
Klicks anhand eines Liniendiagramms die aktuellen Emissionen der
deutschlandweiten Energieerzeugung ansehen oder aber einen bestimmten
Zeitraum auswählen.“
Dr. Felix Osterheider, Vorstandsvorsitzender der fördernden Aloys &
Brigitte Coppenrath Stiftung, hat die Idee überzeugt: „Die Transparenz der
Energieerzeugung ist einer der Schlüsselfaktoren, um sowohl im privaten
Bereich als auch in der Wirtschaft Geräte möglichst emissionsarm nutzen zu
können. Der bewusst anschaulich gestaltete CO2-Kompass bringt alles mit,
um hier als ein zentrales Instrument künftig eine wichtige Rolle zu
spielen.“
- Aufrufe: 218