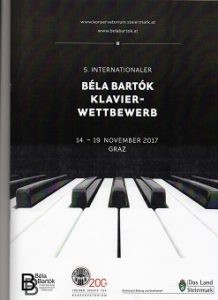Lucerne Festival, Der Cellist Kian Soltani erhält den Credit Suisse Young Artist Award 2018

Den Credit Suisse Young Artist Award 2018 bekommt der Cellist Kian Soltani. Die Jury unter Vorsitz von Michael Haefliger, Intendant von Lucerne Festival wählte den Preisträger nach der gestrigen Audition im Wiener Musikverein. Der Award ist mit CHF 75ʼ000 eine der höchstdotierten Auszeichnungen der Branche und wird 2018 zum zehnten Mal verliehen. Der Preis beinhaltet ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern im Rahmen des Sommer-Festivals. Dieses findet am 8. September 2018 unter der Leitung von Franz Welser-Möst im Konzertsaal des KKL Luzern statt.
Der Cellist Kian Soltani stammt aus einer persischen Musikerfamilie. Er wurde 1992 im österreichischen Bregenz geboren und begann im Alter von zwölf Jahren sein Cellostudium bei Ivan Monighetti an der Musik-Akademie Basel. Überdies nahm er an Meisterkursen unter anderem von Sol Gabetta, und Jens Peter Maintz teil und schloss sein Studium als «Junger Solist» bei Frans Helmerson an der Kronberg Academy ab. 2013 gewann Soltani den Ersten Preis bei der «International Paulo Cello Competition» in Helsinki; 2014 wurde ihm dann der Luitpold-Preis des Kissinger Sommers verliehen. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival erhielt er den «Leonard Bernstein Award». Als Stipendiat wird er von der Anne-Sophie Mutter Stiftung gefördert. Soltani konzertierte als Solist mit dem NDR-Sinfonieorchester, dem Helsinki Philharmonic, der London Sinfonietta, dem Sinfonieorchester Basel und dem Tonhalle-Orchester Zürich. 2015 und 2017 trat Kian Soltani als Solocellist mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter Leitung von Daniel Barenboim bei Lucerne Festival auf. Die Veröffentlichung seines Debut-Albums mit Werken für Cello und Klavier von Schubert, Schumann und Reza Vali ist für Anfang 2018 geplant.
Der Credit Suisse Young Artist Award ist eine Initiative von Lucerne Festival, den Wiener Philharmonikern, der Gesellschaft für Musikfreunde Wien sowie der Credit Suisse Foundation. Herausragende junge Musikerpersönlichkeiten erhalten den Preis für ausserordentliche Leistungen. Die Preisträger erhalten Mittel und eine Auftrittsmöglichkeit im Rahmen von Lucerne Festival. Der Preis ist mit CHF 75ʼ000 dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben (alternierend mit dem Prix Credit Suisse Jeunes Solistes zur Förderung hochbegabter junger Musikerinnen und Musiker in der Schweiz). Das Höchstalter beträgt 30 Jahre. Die Einladung zur Teilnahme erfolgt auf dem Weg der Berufung durch Fachpersonen. Neben dem Vorsitzenden Michael Haefliger sind Professor Alexander Steinberger, Vize-Vorstand der Wiener Philharmoniker, Dr. Thomas Angyan, Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, sowie Dr. Peter Hagmann, Musikkritiker, und Pamela Rosenberg, Intendantin Emeritus der Berliner Philharmoniker, in der Jury. Die bisherigen Preisträger waren Quirine Viersen (Violoncello/2000), Patricia Kopatchinskaja (Violine/2002), Sol Gabetta (Violoncello/2004), Martin Helmchen (Klavier/2006), Antoine Tamestit (Viola/2008), Nicolas Altstaedt (Violoncello/2010), Vilde Frang (Violine/2012), Sergey Khachatryan (Violine/2014) und Simone Rubino (Schlagzeug/2016). Die Credit Suisse ist seit 1993 Hauptsponsor von Lucerne Festival im Sommer und unterstützt die jährlichen Konzerte der Wiener Philharmoniker.
Weitere Informationen zum Künstler: kiansoltani.com
- Aufrufe: 315