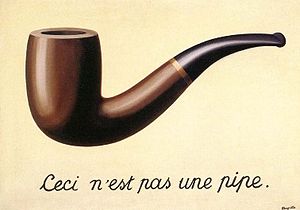Lucerne Festival am Piano, Tastentag 3 Yulianna Avdeeva, 19. November 2017, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Konzertprogramm:
Solistin am Piano Yulianna Avdeeva
Bach Debussy Chopin
Rezension:
Die gebürtige Moskauerin (*3.7.1985), spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Klavier, absolvierte das Klavierstudium an der Moskauer Gnessin Hochbegabten-Musikschule und schloss ihre Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Die Gewinnerin des Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau 2010 erzeugte im Konzertsaal eine fast sakrale Atmosphäre mit ihrer Interpretation von Johann Sebastian Bachs Ouvertüre nach französischer Art (Partita h-Moll) BWV 831. Für diese Komposition verwendete Bach französische und italienische Musik – Stilelemente, was gar nicht so einfach war, gab es doch zu jener Zeit nur selten gedruckte Musiknoten. Die Französische Ouvertüre stellt grosse An- und Herausforderungen, ist sie doch für das zweimanualige Cembalo und Orgel komponiert. Dabei bewies Yulianna Avdeeva sehr viel Stilbewusstsein und Feingefühl. Äusserst konzentriert arbeitete sie die Feinheiten heraus und wirkte dabei immer sehr ernst, mit angespannten Gesichtszügen.
Estampes von Claude Debussy als Highlight des Konzertes
Mit den drei Sätzen Pagodes, La soirée dans Grenade (Ein Abend in Granada) und Jardins sous la pluie (Gärten im Regen) lässt Debussy im Zyklus „Estampes“ in Bildern eine poetische Welt aus Landschaften und fernen Ländern entstehen. Sichtlich entspannter liess die Künstlerin hier die Töne perlen, spielte die fernöstliche des ersten, die maurisch geprägte Exotik des zweiten Satzes feinfühlig aus. Debussy komponierte die Stücke im Sommer 1903 während eines Aufenthalts in Bichain im nördlichen Burgund. Von dort bekräftigt er in einem Brief: „Wenn man sich Reisen nicht leisten kann, muss man sie durch Fantasie ersetzen.“ Im virtuosen Schlusssatz knüpft er an seine zukunftsweisenden Images aus dem Jahr 1894 (HN 846) an.
Furioses Finale mit Chopins Klaviersonate Nr. 3H Moll

Nach Bachs Werk in H Moll zu Beginn, beschloss mit der Klaviersonate Nr. 3H Moll von Frédéric Chopin eine Komposition in derselben Tonart das Konzert. Mit ihren vier Sätzen ist sie in der Sonatensatzform der Wiener Klassik gehalten. Obschon Russin, scheint Avdeeva die Musik Chopins mit der Muttermilch aufgesogen zu haben – die Musik, nicht die gängige Sichtweisen auf diesen Komponisten: Ihre Interpretationen hat sie sich selbst erarbeitet, unter anderem durch seriöses Quellenstudium. Nicht von ungefähr gewann sie 2010 den Chopin-Wettbewerb. Sie huscht im Scherzo des zweiten Satzes auf einer Seite vom Piano zum (synkopierten) Fortissimo, schwebt durch das Largo des dritten, das einer Nocturne gleicht. .Den 4. Satz eröffnen wuchtige Doppeloktaven mit dissonanten und modulierenden Mittelstimmen das Rondo mit großer Gebärde. In den Zwischengruppen wird die Bewegung verdoppelt.
„Die Gesamtsteigerung ist klug berechnet, in ihrer edel-virtuosen Fassung bewundernswert, in der rauschhaften Art slawisch überschäumend, beinahe zügellos, technisch und gestalterisch nur von wirklichen Meistern des Klaviers zu bewältigen urteilte der deutsche Musikwissenschaftler Otto Schumann. (1897 – 1981) über das Werk.
Da Chopin, ebenso wie Debussy, ein grosser Bach-Verehrer war – seine Préludes sind eine Reverenz an das „Wohltemperierte Klavier“ –, spannte sich an diesem Konzertabend eine interkulturelle Traditionslinie durch zwei Jahrhunderte, die in Debussys „Estampes“ ihre Vollendung fand.
Die Künstlerin erfreute sich an einer „Standing Ovation“ und wir uns an zwei kurzen Zugaben.
Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.lucernefestival.ch
Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch https://noemiefelber.ch/
www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li
- Aufrufe: 345