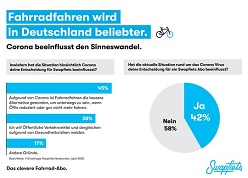Zurückhaltung gegenüber E-Autos liegt nicht nur an den hohen Kosten
Für weitere Strecken nutzen Autofahrerinnen und Autofahrer Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor weit häufiger als Elektroautos. Das gilt nicht nur für
Autos im Privatbesitz, sondern insbesondere auch für Carsharing-Angebote,
bei denen die Kostenstruktur für beide Antriebsarten für die Kundinnen und
Kunden gleich ist. Höhere Anschaffungspreise und Unterschiede in den
laufenden Kosten zwischen E-Autos und Verbrennern sind dementsprechend
nicht der einzige Grund für die geringe Fahrleistung von
Elektrofahrzeugen. Stattdessen dürften auch verhaltensbezogene und nicht-
monetäre Faktoren eine Rolle spielen. Alltägliche Entfernungen sind jedoch
mit einem marktüblichen E-Auto gut zu erreichen.
Dies zeigt die akutelle ZEW-Studie. „Viele Menschen bevorzugen Verbrenner.
Mögliche Gründe dafür sind die Macht der Gewohnheit und Reichweitenangst“,
sagt Prof. Dr. Martin Kesternich, stellvertretender Leiter des ZEW-
Forschungsbereichs “Umwelt und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement“ sowie
Mitautor der Studie.
Die Studie stützt sich zum einen auf die Umfrage „Mobilität in Deutschland
2017“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI). Zum anderen nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Buchungsdaten der Firma Flinkster, dem größten Carsharing-Anbieter in
Deutschland, aus den Jahren 2014 bis 2016. „Beim Flinkster-Carsharing
liegt eine Besonderheit der Nutzung darin, dass die Fahrtkosten pro
gefahrener Zeit und Strecke über alle angebotenen Motortypen innerhalb
einer Fahrzeugklasse immer gleich sind, egal ob elektrisch oder
konventionell“, erklärt Martin Kesternich. „Aufgrund dieser identischen
Kostenstruktur sind beobachtbare Unterschiede in der Nutzung zwischen
Elektroautos und Verbrennern also nicht auf Kostenunterschiede
zurückzuführen, sondern geben vielmehr Auskunft über die Rolle nicht-
monetärer Faktoren für das Fahrverhalten.“
Deutlich geringere Nutzung von Elektroautos beim Carsharing
Für private Fahrzeughalter sind E-Autos in der Anschaffung – auch nach
Einbeziehung der aktuellen staatlichen Förderprämien – meist noch teurer.
Die variablen Kosten pro Kilometer liegen jedoch aufgrund des geringen
Preises (pro Energieeinheit) von Strom gegenüber Benzin oder Diesel
deutlich unter denen herkömmlicher Fahrzeuge. Die Kostenstruktur allein
bietet also Anreize, E-Autos mindestens genau so intensiv zu nutzen wie
konventionelle Fahrzeuge. Wie die Studie zeigt, fahren private Haushalte
ihre E-Autos durchschnittlich 13.052 Kilometer im Jahr. Das sind etwa acht
Prozent weniger als bei privaten Autos mit Verbrennungsmotoren. Dabei ist
die höhere Kilometerzahl herkömmlicher Autos vor allem auf die starke
Nutzung von Dieselautos zurückzuführen.
Bei Carsharing-Diensten dagegen ist der Unterschied zwischen E-Autos und
Autos mit Verbrennungsmotoren noch stärker ausgeprägt: Elektroautos,
welche ganzjährig zur Verfügung standen, erreichen lediglich 21 Prozent
der Jahresfahrleistung herkömmlicher Autos. Neben geringeren
Fahrleistungen pro Buchung werden Elektroautos an Leihstationen, die
Fahrzeuge mit beiden Antriebstechnologien anbieten, auch seltener gebucht
als konventionelle Fahrzeuge. Die deutlich geringere Nutzung von
Elektroautos beim Carsharing interpretieren die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler dahingehend, dass die Preisunterschiede nicht den einzigen
Grund für den wesentlich geringeren Marktanteil von Elektroautos
darstellen. Vor dem Hintergrund dieser Befunde ist es daher derzeit
fraglich, ob die Erhöhung der Förderprämien der E-Mobilität durch
zusätzliche Nachfrage zum Durchbruch verhelfen kann.
„Die Sorge der Autofahrerinnen und Autofahrer entkräften“
Eine mögliche Erklärung für die geringere Nutzung trotz gleicher Kosten
ist eine sogenannte Status-quo-Verzerrung. Das bedeutet, dass Nutzer den
gegenwärtigen Zustand übermäßig bevorzugen und resistent gegenüber
Veränderungen sind. Ein anderer Grund für die Zurückhaltung bei der
E-Mobilität könnte Reichweitenangst sein, also die Angst, mit einem
Elektroauto weite Strecken nicht hinreichend bewältigen zu können.
Diese Reichweitenangst ist für die Mehrheit der gefahrenen Strecken
allerdings unbegründet, wie die Analyse von Tagesfahrleistungen privater
Fahrzeuge und der Carsharing-Daten zeigt. „Selbst bei sehr ungünstigen
Annahmen zu Reichweite und Lademöglichkeiten von E-Autos könnten zwischen
82 und 92 Prozent der täglich mit Verbrennungsmotoren zurückgelegten
Fahrten grundsätzlich auch mit E-Autos bewältigt werden. Bei moderaten
Annahmen nähert sich der Anteil sogar 99 Prozent“, stellt Studienautor
Martin Kesternich fest. „Daher ist es wichtig, dass politische
Entscheidungsträger, Autohersteller und Carsharing-Anbieter die Sorge der
Autofahrerinnen und Autofahrer entkräften. Dies könnte beispielsweise
durch attraktive Leihangebote für die erstmalige E-Auto-Nutzung
unterstützt werden. Des Weiteren ist der Ausbau der öffentlichen
Ladeinfrastruktur eine wichtige Aufgabe für die Politik, denn die
Verfügbarkeit und rasche Nutzbarkeit von Lademöglichkeiten trägt ebenfalls
zur Reduktion der Reichweitenangst bei.“
Ein Sonderfall sind Tage mit besonders hohem Mobilitätsbedarf, etwa
aufgrund von Urlaubsreisen. Solche weiten Strecken lassen sich aktuell mit
Elektroautos nur mit erhöhtem Zeit- und Planungsaufwand zurücklegen. Für
Personen oder Haushalte mit nur einem Fahrzeug können diese seltenen
Fahrten einen Grund darstellen, sich gegen ein Auto mit Elektroantrieb zu
entscheiden. Eine Lösung bestünde zum Beispiel darin, Käuferinnen und
Käufern von E-Autos Gutscheine für Langstreckenfahrten mit der Bahn
anzubieten. Darüber hinaus wäre es auch denkbar, das zeitlich begrenzte
Leihen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in solchen Fällen mit
besonderen Konditionen zu fördern.
- Aufrufe: 281