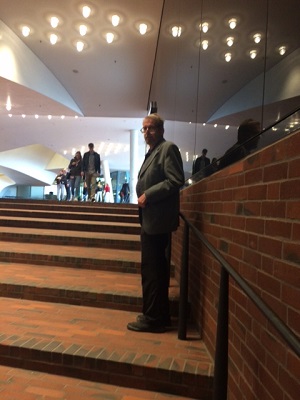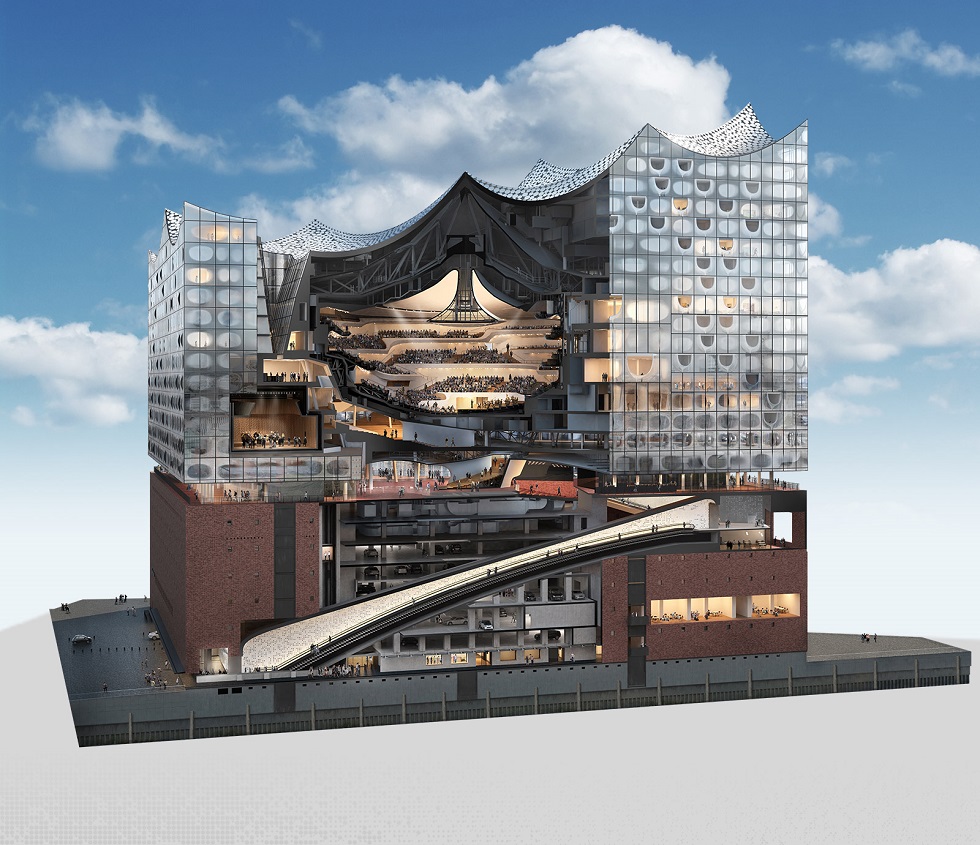Herbert Hubers Vorliebe für den Safran und was er darüber brechtet

Wie ich Safran liebe! Sei es in einem hausgemachten Weisswein-Fischsösschen, in einem Risotto mit Lotoreis aus dem Maggiadelta oder im Emmentaler Lamm-Safran Voressen. Dann die feinen hausgemachten Pastavariationen von «Vilmas Pasta» in Grosswangen oder die fixfertigen Tagliorini aus der Kernser Pasta- Manufaktur. Auch einem Spätzliteig kann man etwas Safran zugeben. Und in der klassischen Bouillabaisse ist er natürlich ein Muss.
Auch vor Süssem macht der «König der Gewürze» nicht Halt. Ihm wird schon in dem Kinderliedchen «Backe, backe Kuchen» mit der Zeile «Safran macht den Kuchen gel» die Ehre erwiesen. Auch eine Caramelcreme, mit Safran und etwas Lavendel gewürzt, mundet herrlich. Das Internet liefert zahllose weitere Rezeptideen mit Safran. Toll sind auch die Safranrezepte von Daniel Bumann, bekannt seit der Sendung «Der Restauranttester». Als gebürtiger Walliser beherrscht er das Kochen mit Safran aus dem FF. Eine meiner eindrücklichsten kulinarischen Erinnerungen mit Safran habe ich damals noch in seinem Restaurant Chesa Pirani erleben dürfen.
Zeus schlief auf einem Safranbett

Die Geschichte des Safrans geht weit zurück in die griechische Mythologie, wo behauptet wird, dass Zeus auf einem Bett aus Safran geschlafen habe. Unvorstellbar fast. Verwendet wurde Safran damals schon als Heil- und Würzmittel. Im achten Jahrhundert führten die Araber (Maurenherrschaft) die Spanier in die Safrankultur ein, und über Frankreich gelangte er in die Schweiz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Österreich das Anbauzentrum Mitteleuropas. Des Safrans höchste Qualität wurde als «Crocus austriacus» bezeichnet. Safran – der wissenschaftliche Name lautet Crocus sativus – ist eine Krokus-Art und hat ihren Namen aus dem Arabisch-Persischen «za’faran». Aus den Stempeln ihrer Blüten wird das ebenfalls Safran genannte Gewürz gewonnen. Nur einmal pro Jahr blüht Safran. Auch bei uns in der Schweiz im Walliser Dörfchen Mund und neustens auch im Bündnerland.
Violettes Blütenmeer in Mund

Man weiss, dass Safran in ganz Europa schon seit der Renaissance sehr gefragt ist und damit intensiv gehandelt wurde. Die Verwendung von und der Handel mit Safran sind in der Schweiz mindestens seit dem 15. Jahrhundert gut belegt. Aber sein Anbau? Die Legende erzählt, dass Safran im Dorf Mund seit dem 14. Jahrhundert ununterbrochen angebaut wurde. Es ist nur eine sehr geringe Produktion mit zwei bis drei Kilo pro Jahr, aber ihr Ruf geht weit über die Grenzen des Wallis hinaus. Seit 1977 unternehmen die Einwohner des Dorfes alles, um ihr Verschwinden zu verhindern. So ist es ihnen gelungen, diese Kultur zu bewahren und die Produktion noch zu steigern. Das Dorf wurde damit zu einer einmaligen Besonderheit in den Alpen: Es beherbergt eine Safrananbaufläche von gut anderthalb Hektar (14 000 m2).

Ich erinnere mich an einen Ausflug nach Mund oberhalb von Naters im Wallis. Grenzenlos war mein Staunen ob des violetten Blütenmeeres. Riechen tut man dabei rein nichts. Der unverkennbare Safrangeruch entsteht nämlich erst nach dem Trocknen der Blüten. Feinsandig, leicht lehmig und lockertrocken – eher mager muss die Beschaffenheit des Bodens sein. Das ist in Mund, auf 1200 Metern über Meer an einem Sonnenhang, der Fall. Eine Reise dorthin lohnt sich. Der hiesige Safran ist AOP-zertifiziert. Da die Nachfrage grösser ist als das Angebot, ist der Safran hier meistens ausverkauft. In den Gaststätten des 700-Seelen- Dorfes sind feinste Safranspezialitäten von Reis über Kuchen und Brot bis hin zum Likör erhältlich. Auf dem beschilderten Safran-Lehrpfad,der durch verschiedene Äcker führt, wird auf Infotafeln Wissenswertes erläutert. Warum Safran so teuer ist, beispielsweise. Um ein einziges Gramm Safran zu erhalten, braucht es nämlich mindestens 180 Blüten. Denn nur die oberen drei Narbenschenkel (Fäden) enthalten das intensive Safranaroma.
Und mit dem Handpflücken müssen sich die Erntehelfer beeilen, denn die Narben müssen am gleichen Tag gezogen werden. Es ist also nur verständlich, dass Safran fast wie Gold behandelt wird. Kaufen kann man dieses «rote Gold» in kleinen Portionen als Pulver oder als Safranfäden.
Vorsicht vor Fälschungen

Es gibt auch Fälschungen, die leider weit verbreitet sind. Ich warne vor Safrankäufen in einem Souk oder Gewürzmarkt eines exotischen Landes. Souvenir hin oder her. Fälschungen können aus einer Kurkumamischung bestehen. In Spanien kann man den sogenannten Colorante kaufen, welcher sehr oft zum Färben der Paella dient, aber niemals den Geschmack echten Safrans hat. Die Farbe allerdings schon. Etwas davon auf die Hosen, das Hemd oder die Bluse – und futsch sind die Kleidungsstücke.
Auch Safranfäden werden gefälscht. Wer mit dem Aussehen und Geruch des richtigen Safrans vertraut ist, kann den Unterschied erkennen. Testen kann man auch, indem man zu einer Lösung des Pulvers Natronlauge beigibt. Handelt es sich um reinen Safran, bleibt die Lösung gelb. Ist Kurkuma drin, wird die Lauge trüb und verfärbt sich rot. Dies nur als guter Tipp, um einem allfälligem «Bschiss» vorzubeugen. Zu Hause allerdings ist dieser Test zu spät.
Konkurrenz im Bündnerland

Das Safrandorf Mund hat im Bündnerland Konkurrenz erhalten. Vorerst allerdings zwar nur eine bescheidene: in Mund werden um die 3 kg Trockengewicht geerntet. Doch zumindest stehen die Zeichen gut, dass Schweizer Safran, sorgfältig und selektiv angebaut, noch mehr als bis anhin seine Liebhaber finden wird.
Text www.herberthuber.ch
Fotos www.pixelio.de
Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch
- Aufrufe: 93