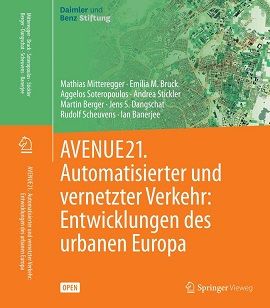Automatisierter Verkehr: So wird er unsere Städte verändern
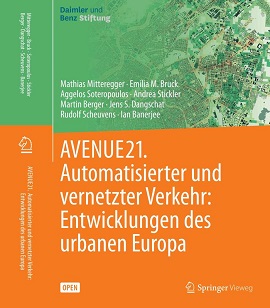
Studie der Technischen Universität Wien liefert neue Erkenntnisse über
Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten des automatisierten Verkehrs.
Die Studie ist als Open-Access-Publikation bei Springer Vieweg erschienen:
www.springer.com/de/book/97836
Automatisierte und vernetzte Fahrzeuge sind Hoffnungsträger für Politik
und Wirtschaft: Sie sollen den Verkehr in Zukunft sicherer und effizienter
machen und so einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Diese Hoffnung
trifft allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu, wie eine
umfangreiche Studie der Technischen Universität Wien zeigt. Lediglich wenn
automatisierte Fahrzeuge als Erweiterung des bestehenden öffentlichen
Verkehrs eingesetzt werden, also Fahrzeuge und Fahrten geteilt werden,
kommt es zu einer Reduktion des Verkehrs. Andernfalls nimmt das
Verkehrsaufkommen zu – und zwar erheblich.
Die bislang umfangreichste Studie, die sich mit dieser Fragestellung aus
interdisziplinärer Perspektive befasst, ist soeben als Buch „AVENUE21.
Automatisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa“
im Verlag Springer Vieweg als Open-Access-Publikation erschienen. Das
Forschungsprojekt AVENUE21 und die Buchpublikation wurden von der Daimler
und Benz Stiftung gefördert. „Es ist dringend notwendig, dass sich alle,
die an der Entwicklung europäischer Städte beteiligt sind, mit dem Thema
‚Automatisierte Fahrsysteme‘ auseinandersetzen“, so Mitherausgeber Prof.
Rudolf Scheuvens, Dekan der Fakultät Architektur und Raumplanung. „Deshalb
war es uns und der Stiftung auch besonders wichtig, dass unsere
Untersuchung der Öffentlichkeit und allen Stakeholdern uneingeschränkt und
kostenlos zur Verfügung steht und für einen offenen Diskurs als Grundlage
dienen kann.“
Angesichts der globalen Klimakrise und des Ziels, lebenswerte Städte zu
schaffen, könne es sich unsere Gesellschaft schlichtweg nicht leisten,
eine Technologie zuzulassen, die zusätzliches Verkehrsaufkommen generiere.
Es gebe zahlreiche verkehrs- und siedlungspolitische Probleme, die
angesprochen werden müssten, um eine gezielte und menschengerechte
Stadtentwicklung zu ermöglichen.
Das Wissenschaftler-Team der TU Wien, das mehr als zwei Jahre in dem
Forschungsprojekt arbeitete, vertritt die Ansicht, dass in den kommenden
Jahrzehnten die technologischen Einschränkungen automatisierter Fahrzeuge
eine neue Ungleichheit verursachen könnten. Diese entsteht durch die
Heterogenität und oftmals hohe Komplexität des Straßennetzes in
europäischen Städten. „Es klingt paradox, aber unser Buch ist die erste
Studie, die umfangreich Wirkungen und Potenziale von automatisierten und
vernetzten Fahrzeugen untersucht und dabei die Straße nicht allein als
Verkehrsraum, sondern auch als Lebensraum betrachtet. Deswegen kommen wir
auch vielfach zu anderen Ergebnissen als Studien, die die Straße allein
auf ihre Transportfunktion reduziert haben“, so Scheuvens. Autobahnen,
Industrie- oder Gewerbestraßen könnten relativ schnell automatisiert
befahren werden. Aber Straßen, die durch Gastgärten, anliegende Parks oder
Schulen belebt sind, werden, so ist das Forscher-Team überzeugt,
langfristig nicht automatisiert befahren werden können. Automatisierte
Services würden deswegen sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr nur
für ausgewählte Personen und Betriebe zur Verfügung stehen.
Dieser Zustand muss seitens Politik und Planung anerkannt und bestehende
Hoffnungen müssen relativiert werden. Die Forschenden kommen zum Schluss,
dass – unabhängig von der technologischen Machbarkeit – die meisten
negativen Effekte von automatisierten Fahrzeugen nur dann vermieden werden
können, wenn ausschließlich bestimmte Straßenzüge für deren Einsatz
geöffnet würden. Diese und weitere Weichenstellungen verlangen schon heute
gezieltes und entschiedenes Handeln.
„Die Publikation ‚AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr:
Entwicklungen des urbanen Europa‘ fasst wesentliche Erkenntnisse praxisnah
zusammen. Wir erörtern im Buch, welche Fragen der Stadt- und
Mobilitätsentwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren beantwortet
werden müssen. Gezielt eingesetzt, können automatisierte Fahrzeuge
hochqualitative Mobilitätsservices in Gebieten ermöglichen, in denen der
klassische öffentliche Nahverkehr scheitert“, resümiert Dr. Mathias
Mitteregger, Koordinator des Forschungsprojekts.
Die Publikation ist frei verfügbar unter
www.springer.com/de/book/97836
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: http://avenue21.city/
- Aufrufe: 494