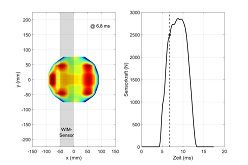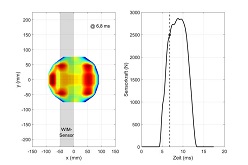DEVK reduziert E-Scooter-Beiträge um bis zu 40 Prozent

Tatsächlich kommen Unfälle mit E-Scootern seltener vor als gedacht – zumindest im Vergleich mit Mopeds. Deshalb senkt die DEVK ab März deutlich die Versicherungsbeiträge.Aus dem Stadtbild sind sie kaum mehr wegzudenken: E-Scooter. Neben den zahlreichen Verleihrollern nehmen auch die privaten Anschaffungen zu. Eine Haftpflichtversicherung ist für E-Scooter Pflicht. Am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr für alle Fahrer von Mopeds und Elektrokleinstfahrzeugen. Wer seinen E-Scooter bei der DEVK absichert, kann sich freuen: Ab dem neuen Verkehrsjahr bietet die Versicherung Privatbesitzern verbesserte Konditionen an. E-Scooter-Fahrer ab 23 Jahre zahlen nur 28 Euro pro Versicherungsjahr anstatt wie bisher 48 Euro. Das entspricht einer Ermäßigung von rund 42 Prozent. Für die Altersgruppe zwischen 18 bis 22 Jahre gibt es einen Preisnachlass von rund 35 Prozent: statt 75 Euro zahlen Besitzer jährlich nur noch 49 Euro. Lediglich Fahrer unter 17 Jahre zahlen wie bisher 99 Euro pro Versicherungsjahr, weil sie ein höheres Unfallrisiko haben.
Sticker statt Nummernschild
Anders als bei Mopeds müssen Besitzer kein Blechschild an ihrem E-Scooter anbringen, sondern nur einen Versicherungsaufkleber – gut sichtbar natürlich. Er gilt bis Ende Februar 2021, dann wird ein neuer Sticker fällig. Den gibt es zum Beispiel in jeder DEVK-Geschäftsstelle. Zusätzlich bietet die DEVK für E-Scooter, die bis zu 2.500 Euro wert sind, eine Teilkaskoversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung an. Sie schützt den Besitzer bei Schäden am eigenen Fahrzeug – beispielsweise bei Diebstahl. Auch hier senkt die DEVK den Preis für das kommende Versicherungsjahr: Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren zahlen statt 50 Euro nur noch 40 Euro für die Teilkaskoversicherung. Für die jüngere Altersklasse bis 17 Jahre bleibt der Beitrag von 50 Euro bestehen, ab 23 zahlen Fahrer weiterhin 30 Euro.
Fahren schon ab 14, leihen erst ab 18 Jahre
Neben der Versicherungspflicht gelten noch weitere Regeln: Jugendliche dürfen zum Beispiel schon ab 14 Jahren einen E-Scooter fahren, wenn er sich im privaten Besitz befindet. Leihen können Teenies die praktischen Flitzer jedoch in der Regel erst ab einem Alter von 18 Jahren – so steht es in den Nutzungsbedingungen der meisten Verleihfirmen. Einen Führerschein brauchen Fahrer dagegen nicht. Denn in Deutschland dürfen nur E-Scooter auf die Straße, die höchstens 20 Stundenkilometer schnell fahren und eine Betriebserlaubnis haben. Zugelassen sind sie für Radwege und Straßen. Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und in von Städten festgelegten Sperrzonen sind E-Scooter nicht erlaubt.
- Aufrufe: 690