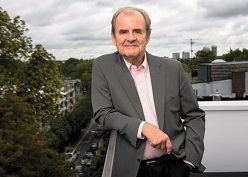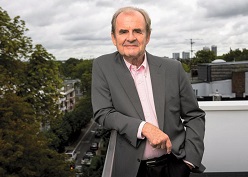Leben mit Herzschwäche: Was können Betroffene für ihr Herz tun?

Atemnot, Abgeschlagenheit, Klinikeinweisung: bei Herzinsuffizienz sinken
meist Lebensqualität und Prognose der Betroffenen. Die Herzwochen
informieren über Ursachen und Symptome und wie neue Therapien, gesunder
Lebensstil und digitale Technologien Menschen mit Herzschwäche helfen
Das Treppensteigen wird zur Tortur und bei der sonst so erholsamen
Bergwanderung kommt man plötzlich nicht mehr mit. Nach Schätzungen leiden
hierzulande bis zu vier Millionen Menschen an Herzschwäche
(Herzinsuffizienz), bei der das Herz aus unterschiedlichen Gründen nicht
mehr in der Lage ist, den Körper mit ausreichend Blut und Sauerstoff zu
versorgen. Schäden insbesondere an Herz, Gehirn, Nieren und Muskeln sind
die Folge. Bei Betroffenen kommt es zu Symptomen wie Kurzatmigkeit schon
bei geringer Anstrengung und Leistungseinschränkung. Mit über 37.000
Sterbefällen pro Jahr ist die Herzinsuffizienz dritthäufigste
Todesursache. Zwar können auch junge Menschen an einer Herzinsuffizienz
erkranken, zum Beispiel nach entzündlichen Herzmuskelerkrankungen wie
Myokarditis. Wegen des demografischen Wandels und der älter werdenden
Gesellschaft sowie dank verbesserter Therapiemöglichkeiten, nimmt auch der
Anteil der herzinsuffizienten Patienten noch weiter zu. Von den 60- bis
79-Jährigen sind etwa zehn Prozent von Herzinsuffizienz betroffen.
„Mit rund 450.000 vollstationären Fällen pro Jahr ist die Herzschwäche die
häufigste Diagnose für Krankenhausaufnahmen und eine enorme
Herausforderung für unser Gesundheitswesen und die gesamte Gesellschaft.
Denn auch an Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetes sowie Rauchen und
Bewegungsmangel als klassische Risikofaktoren für Herzkrankheiten, die in
die Herzschwäche münden, leiden viele Millionen Betroffene“, warnt der
Kardiologe Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Herzstiftung. In etwa 70 Prozent der Fälle gehen der
Herzinsuffizienz lange bestehende Grunderkrankungen wie die koronare
Herzkrankheit (KHK), aus der der Herzinfarkt entsteht, und Bluthochdruck
voraus. „Bei der Prävention dieser Grunderkrankungen müssen wir ansetzen.
Das bedeutet aber zugleich: Herzschwäche ist kein unabwendbares Schicksal.
Ihre Risikokrankheiten lassen sich durch eine gesunde Lebensstilführung im
Idealfall vermeiden oder bei frühzeitiger Therapie positiv beeinflussen,
damit es nicht zur Herzschwäche kommen muss.“ Um die Bevölkerung für die
Herzschwäche zu sensibilisieren, stehen gezieltes Wissen über die
häufigsten Ursachen, Warnzeichen und aktuelle Therapien der
Herzinsuffizienz im Zentrum der bundesweiten Herzwochen der Herzstiftung.
Diese finden unter dem Motto „Stärke Dein Herz! Herzschwäche erkennen und
behandeln“ mit zahlreichen Aufklärungsaktionen im gesamten Bundesgebiet
statt. Eine Fülle an Infos für Betroffene sind unter
<herzstiftung.de/herzwochen> abrufbar sowie über soziale Medien unter den
Hashtags #herzwochen und #staerkedeinherz
Herzinsuffizienz-Therapie: Weniger plötzliche Herztode und bessere
Lebensqualität
Medizinische Therapien haben in den vergangenen Jahren insbesondere dazu
beigetragen, dass es bei Herzschwäche heute viel seltener zum plötzlichen
Herztod kommt als noch vor einigen Jahren. Das gilt besonders für
Patienten mit einer systolischen Herzschwäche und einer reduzierten
Auswurfleistung (zirka 50 Prozent der Herzinsuffizienzpatienten). „Bei
ihnen konnte das Risiko eines plötzlichen Herztods auf zwei bis vier
Prozent gesenkt werden – früher waren es acht bis zehn Prozent oder gar
mehr“, betont Prof. Voigtländer. Leitlinien empfehlen eine
Therapiestrategie mit vier Medikamentengruppen: Betablocker, ACE-
Hemmer/Sartane oder ARNIs (Angiotensin-Rezeptor-Neprilys
(Mineralkortikoid-Rezeptoranta
Arzneimittel wirken auf unterschiedliche Weise positiv auf eine
Herzinsuffizienz ein.“ Zusätzlich erhalten Herzschwäche-Patienten zum
Vermeiden von Wassereinlagerungen im Körper (Ödeme) Entwässerungsmittel
(Diuretika). Insgesamt verbessern diese Medikamente bei konsequenter
Einnahme die Prognose, indem sie den Herzmuskel stabilisieren und dadurch
unter anderem auch lebensgefährliche Rhythmusstörungen reduzieren. „Die
konsequente Medikamenteneinnahme ist für den Erfolg der Therapie besonders
wichtig, sonst besteht die Gefahr einer lebensbedrohlichen Entgleisung der
Herzschwäche und einer Krankenhausaufnahme.“ Weitere Infos:
<herzstiftung.de/herzschwaeche
Kleiner Notarzt in der Brust: Implantierbarer Defibrillator oder
Schrittmacher
Bringen Medikamente keine ausreichende Verbesserung der Herzschwäche,
kommen vielen Patienten in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung
implantierbare medizinische Geräte zu Hilfe: durch die Implantation eines
Herzschrittmachers (bei zu langsamem/schwachem Herzschlag) oder eines
Defibrillators (englische Abkürzung ICD: Implantable Cardioverter-
Defibrillator) (bei gefährlich schnellem und unregelmäßigem Herzschlag).
„Wie ein implantierter Notarzt kann der Defibrillator, klein wie ein
Herzschrittmacher, sehr schnelle lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen
wie Kammerflimmern durch einen elektrischen Schock oder eine
Überstimulation beenden“, erklärt der Kardiologe und Intensivmediziner
Prof. Voigtländer.
Ein sogenanntes CRT-System zur kardialen Resynchronisationstherapie
synchronisiert die Kontraktion der Herzkammern und verbessert damit die
Pumpfähigkeit des Herzens. CRT-Systeme sind multifunktional und können
zusätzlich einen zu langsamen Pulsschlag verhindern und besitzen eine
Defi-Funktion. Die CRT-Therapie kann die Prognose der chronisch
schwerkranken Patienten verbessern und bei mindestens der Hälfte der
Patienten auch die Lebensqualität.
Angriffspunkte für die Therapie: Ursachen und Risikokrankheiten der
Herzschwäche
Die chronische Herzschwäche ist in den meisten Fällen das Endstadium
anderer Herz-Kreislauf- Erkrankungen. Je nach betroffenen Teilen des
Herzens, unterscheiden Mediziner verschiedene Formen der Herzschwäche. Am
häufigsten sind die systolische und diastolische Herzinsuffizienz. Für die
Ausrichtung der Therapie ist die Diagnose der Herzschwäche-Form und ihrer
Ursachen wichtig.
1. Gestörte Pumpfunktion des Herzens (Systolische Herzinsuffizienz)
Diese Form der Herzschwäche ist gekennzeichnet durch eine gestörte
Pumpfunktion der Herzkammern. Der Herzmuskel kann sich dabei nicht kräftig
zusammenziehen. Meist ist die linke Herzkammer betroffen. Wenn sie in der
Auswurfphase (Systole) nicht genügend pumpt, gelangt zu wenig Blut mit
Sauerstoff und Nährstoffen in den Körper zu den Organen. Sie wird auch als
Herzschwäche mit reduzierter Auswurfleistung* (englisch abgekürzt: HFrEF
für Heart Failure with reduced Ejection Fraction) bezeichnet.
Häufigste Ursachen sind die KHK, aus der der Herzinfarkt entsteht, und
Bluthochdruck mit Schädigung des Herzmuskels („Hochdruckherz“). Beim
Herzinfarkt geht die Pumpleistung durch eine Schädigung des Herzmuskels
und Umbauprozesse/Vernarbungen im Herzgewebe verloren. Beim Hochdruckherz
führt die dauerhafte Drucküberlastung der linken Herzkammer zu einer
Herzwandverdickung. Weniger häufig sind Schädigungen des Herzmuskels
beispielsweise durch entzündliche Erkrankungen (Virus-Myokarditis),
Herzklappenfehler und Herzrhythmusstörungen (zu schneller und
unregelmäßiger Pulsschlag) wie Vorhofflimmern.
2. Füllungsstörung des Herzens (Diastolische Herzinsuffizienz)
Bei dieser Form der Herzschwäche können sich die Herzkammern nicht mehr
ausreichend mit Blut füllen. Die Herzmuskulatur ist zu steif geworden, und
kann sich krankheitsbedingt in der Erschlaffungsphase (Diastole) nicht
genug entspannen, um ausreichend mit Blut gefüllt zu werden. So gelangt
trotz normaler Pumpleistung nicht genug Blut in den Körper. Lange Zeit war
dabei nicht bekannt, dass auch eine beeinträchtigte diastolische Funktion
der linken Herzkammer von Bedeutung ist. Das hat sich geändert. Heute
spricht man bei einer Füllungsstörung der linken Herzkammer von einer
Herzschwäche mit erhaltener Auswurfleistung (englisch kurz HFpEF für Heart
Failure with preserved Ejection Fraction). Zu den klassischen
Risikofaktoren und Auslösern einer Füllungsstörung des Herzens zählen
insbesondere Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen,
Übergewicht und Bewegungsmangel. Und auch das Alter sorgt – leider – für
eine zunehmende Versteifung des Herzmuskels.
„Wer herzkrank ist und diesen Zusammenhang kennt, kann durch sein
Verhalten ein Abgleiten in eine Herzschwäche durch frühzeitige Therapie
dieser Risikofaktoren vermeiden“, erläutert Prof. Voigtländer, Ärztlicher
Direktor des Agaplesion Bethanien-Krankenhauses Frankfurt am Main.
*Auswurfleistung/-fraktion = die Menge Blut, die die linke Herzkammer im
Verhältnis zur Gesamtmenge Blut, die sich in der Herzkammer befindet, in
den Körper pumpt.
Beste Strategie: Diese fünf schädlichen Begleiterkrankungen behandeln
Ziel der Therapie der Herzschwäche ist es, ihr Fortschreiten zu stoppen
oder zu verlangsamen, eine Entgleisung zu verhindern und so die
Lebensqualität und Prognose zu verbessern. Das erfordert eine erfolgreiche
Therapie der risikoreichen Begleiterkrankungen. „Begleiterkrankungen
begünstigen das Entstehen einer Herzschwäche und beeinflussen ihren
weiteren Verlauf negativ. Ziel jeder Therapie ist es daher, auch diese
Risikoerkrankungen in den Griff zu bekommen“, betont der Kardiologe. Dabei
stehen insbesondere folgende Begleiterkrankungen und Therapieverfahren im
Fokus:
KHK (Arteriosklerose)/Herzinfarkt – Wann Stent, wann Bypass?
Bei der Therapie von Durchblutungsstörungen des Herzmuskels durch die KHK
und den Herzinfarkt tragen meistens Katheter-Verfahren zur Aufdehnung
eines verengten beziehungsweise zur Rekanalisation eines verschlossenen
Herzkranzgefäßes mit einer Gefäßstütze (Stent)/Ballon (PCI) dazu bei, die
Durchblutung des betroffenen Herzmuskelareals zu verbessern oder ganz
wiederherzustellen. Die seltenere chirurgische Bypassoperation kommt bei
KHK-Patienten mit der interventionell schwer zu behandelnden
Hauptstammstenose und der 3-Gefäßerkrankung zum Einsatz, weil eine
Aufdehnung hochgradig verengter oder verschlossener Herzgefäße durch einen
Ballon/Stent nicht ausreicht.
Bluthochdruck – Blutdruck senken und „Hochdruckherz“ vermeiden
Bluthochdruck muss medikamentös – flankiert von Lebensstilmaßnahmen wie
Bewegung und gesunde Ernährung – gesenkt werden, um eine Schädigung des
Herzens aufgrund der dauerhaften Drucküberlastung der linken Herzkammer,
die zur Herzwandverdickung führt, zu verhindern. Sonst droht ein
sogenanntes Hochdruckherz mit verminderter Pumpleistung.
Herzrhythmusstörungen – Katheterablation bei Vorhofflimmern
Vorhofflimmern zählt zu den zehn häufigsten Begleitdiagnosen von
Herzschwächepatienten. Dauerhaftes Vorhofflimmern hat einen sehr negativen
Einfluss auf eine Herzinsuffizienz und erhöht die Sterblichkeit und
Schlaganfallrate. Bei Patienten mit Herzschwäche und Vorhofflimmern setzt
sich immer mehr die Katheterablation als Therapie durch. „Vorhofflimmern
zu beseitigen, hat immer positive Effekte auf eine Herzschwäche, bei jedem
Schweregrad“, betont Kardiologe Prof. Voigtländer.
Diabetes – Herzmuskel und Gefäße mit SGLT-2-Hemmer schützen
Bei jedem dritten Patienten mit (diastolischer) Herzschwäche findet sich
die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus Typ II. Diabetes verschlechtert die
Prognose der Herzschwäche erheblich wegen der Schäden, die zu viel Zucker
im Blut an den großen und kleinen Gefäßen sowie am Herzmuskel selbst
verursacht. Treten Herzschwäche und Diabetes gemeinsam auf, erhöht sich
deutlich das Risiko für eine Krankenhauseinweisung wegen der Herzschwäche
oder vorzeitigen Tod. Patienten mit Diabetes sollten, sofern keine
medizinischen Gründe dagegen sprechen, mit einem sogenannten SGLT-2-Hemmer
(z.B. Empagliflozin oder Dapagliflozin) behandelt werden.
Nierenerkrankungen – auch für das Herz ein Problem
Etwa ein Viertel der Patienten mit diastolischer Herzschwäche ist
zusätzlich nierenkrank. Nieren- und Herzschwäche begünstigen sich
gegenseitig: Die Nierenschwäche verschlimmert die Herzschwäche, die
Herzschwäche beeinträchtigt die Funktion der Nieren. Kranke Nieren melden
sich nicht mit Schmerzen. Umso wichtiger ist ihre Erkennung mit Hilfe
diagnostischer Marker, die eine Nierenschädigung anzeigen: die geschätzte
glomeruläre Filtrationsrate (eGF) und der Eiweißstoff Albumin im Urin.
Gefährliche Entgleisung der Herzschwäche: Warnzeichen und Schutzmaßnahmen
Eine Entgleisung der Herzschwäche (Herzdekompensation) ist einer der
häufigsten Anlässe für eine Krankenhauseinweisung und negativ für die
Prognose der Herzschwäche. „Patienten können aktiv dazu beitragen, solch
eine Situation zu vermeiden. Ihr Eigenengagement ist für die Therapie
enorm wichtig“, betont der Intensivmediziner Prof. Voigtländer. Zur
Entgleisung kommt es, wenn etwa Medikamente abgesetzt oder nicht in der
verordneten Dosierung eingenommen oder falsch kombiniert werden. Oftmals
fehlt zudem das Wissen über die Warnzeichen einer Entgleisung, bei der ein
Arzt aufzusuchen ist:
- Gewichtszunahme um mehr als zwei Kilo in 1 bis 3 Tagen (zeigt
Tendenz zur Flüssigkeitseinlagerung, Ödeme, bzw. zu hohem
Flüssigkeitsverlust an),
- plötzliches Anschwellen von Beinen und Bauch,
- plötzliche zunehmende Mühe beim Atmen,
- plötzliche Luftnotanfälle mit Todesangst (durch Blutstauung im
Lungenkreislauf als Folge einer Bluthochdruckkrise),
- kurz dauernde Anfälle von Bewusstlosigkeit,
- starke Schmerzen im Brustbereich,
- schneller als zuvor eintretende Müdigkeit,
- Herzrasen oder viel zu schneller/unregelmäßiger Herzschlag,
- zunehmend nächtliches Husten und erschwertes flaches Liegen,
- selteneres Urinlassen als üblich.
Das tägliche Protokollieren von Gewicht, Blutdruck und Puls trägt dazu
bei, Komplikationen wie Vorhofflimmern, Blutdruckkrisen oder Ödemen und
dadurch einer Herzdekompensation vorzubeugen. Für Betroffene gibt es dafür
ein spezielles Herztagebuch (<herzstiftung.de/herztagebuch
sollten auch die folgenden Maßnahmen zum Schutz vor einer
Krankenhausaufnahme beachten:
Moderater Salzverbrauch: Salz bindet Wasser im Körper und kann dadurch den
Blutdruck ansteigen lassen, und dieser höhere Blutdruck wiederum belastet
das schwache Herz zusätzlich. Daher sollten Herzschwächepatienten
übermäßigen Salzverbrauch im Essen vermeiden.
Auf Flüssigkeitszufuhr achten: Zu große Flüssigkeitsmengen (über 2 Liter
am Tag) können zu Bluthochdruck und Atemnot führen, vor allem, wenn
bereits Ödeme bestehen. Das Herz und die Nieren können die
Flüssigkeitsmengen dann nicht bewältigen. Eine zu geringe Wasseraufnahme
kann aber auch ungünstig sein. Wegen der Diuretika-Einnahme ist schnell
die Grenze unterschritten, wo es zu Verwirrtheit und schnellem Herzschlag
kommen kann. Die Trinkmenge daher am besten mit Ärztin/Arzt individuell
besprechen.
Unbedingt Impfen: Eine Überlastung des ohnehin geschwächten Herzens durch
eine bakterielle oder Virus-Infektion gilt es zu vermeiden. Die Deutsche
Herzstiftung rät Herzpatienten, sich unbedingt gegen Grippe (Influenza),
Coronavirus und Pneumokokken impfen zu lassen.
Selbst aktiv gegen Herzschwäche: Engagement der Patienten „A und O der
Therapie“
Herzschwäche ist in den meisten Fällen eine chronische Erkrankung, mit der
Betroffenen dauerhaft leben müssen. Eine aktive Rolle der Patienten, indem
sie sich mit ihrer Erkrankung und der Therapie beschäftigen und sie
verstehen, ist die Basis für den Erfolg der Therapie. Die
Herzinsuffizienztherapie ist schon aufgrund der Begleiterkrankungen
komplex und für viele Patienten möglicherweise mit Rückschlägen verbunden:
wegen der Symptome, wegen Nebenwirkungen der Medikamente, wegen Ängsten
und Depressionen oder aufgrund einer Entgleisung. Die enorme Entwicklung
der Medizin in Bezug auf die Herzinsuffizienz mit modernen Medikamenten,
verbesserter CRT-Geräte, digitaler Techniken sowie den
Herzunterstützungssystemen bei schwerer Herzinsuffizienz ermöglicht den
Patienten heute eine wesentlich bessere Lebensqualität. „Das Engagement
von Arzt und Patienten, die an einem Strang ziehen, ist daher das A und O
der Therapie“, untermauert der Herzstiftungs-Vorsitzende. Diese aktive
Rolle der Patienten müsse sich gleichzeitig auf einen gesunden Lebensstil
richten mit Gewichtsnormalisierung, regelmäßiger Bewegungstherapie (vorab
ärztlich kontrolliert) aus Ausdauer- und muskulärem Kraft-
Ausdauertraining, gesunder Ernährung (Mittelmeerküche) und Verzicht auf
Rauchen und Alkohol sowie Stress-Management. Tipps zur Bewegung:
<herzstiftung.de/herzschwaeche
(wi)
Zusatzinformation
Zukunftsmodell Behandlungsnetzwerke?
Patientenversorgung engmaschig und telemedizinisch
Für die Versorgung von Herzinsuffizienzpatienten ist auch eine engmaschige
Überwachung besonders bei höheren Schweregraden der Herzschwäche sehr
wichtig. Digitale Technologien wie Telemonitoring und tragbare „Smart
devices“ (Smartwatch, digitale Waage etc.) spielen eine wichtige Rolle,
auch weil sie das Selbstmanagement des Patienten erleichtern. Das zeigt
sich etwa bei den neuen sogenannten Behandlungsnetzwerken.
„Gerade nach stationären Aufenthalten wegen einer Entgleisung der
Herzschwäche oder bei höheren Schweregraden der Krankheit ist eine
optimale ambulante Versorgung der Patienten unverzichtbar“, berichtet
Prof. Voigtländer. Behandlungsnetzwerke aus Hausärzten, Kardiologen,
Schwerpunktpraxen und spezialisierten Kliniken werden den Anforderungen an
eine engmaschige Versorgung von Herzschwächepatienten besonders gerecht.
Solche spezialisierten Einrichtungen wie die von der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zertifizierten „Heart Failure Units“
(HFU): HFU-Schwerpunktkliniken/-praxe
können besonders intensiv auf die Bedürfnisse von Herzschwächepatienten
eingehen. Zum Beispiel über die Mitbetreuung durch spezialisiertes nicht-
ärztliches Assistenzpersonal für Herzinsuffizienz. Auch bieten HFU-Praxen
häufig nach stationärem Aufenthalt wegen Herzdekompensation rascher
Termine zur Nachkontrolle an und halten pro Woche eine bestimmte Anzahl an
Notfallterminen frei für Patienten mit akuter Luftnot. „Das ermöglicht
eine schnelle Diagnostik und eine zügige Anpassung der Therapie, wodurch
idealerweise einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus vorgebeugt
wird“, erklärt Voigtländer.
Ein großer Fortschritt ist die telemedizinische Betreuung (Telemonitoring)
von Patienten, die im Rahmen der Regelversorgung seit 2022 unter
bestimmten Voraussetzungen möglich ist, etwa wenn
- die Herzleistung des Patienten eingeschränkt ist (Auswurffraktion
der linken Herzkammer gleich oder weniger 40 Prozent),
- der Patienten zusätzlich ein ICD- oder CRT-Gerät trägt,
- in den vergangenen zwölf Monaten wegen Herzschwäche eine
stationäre Krankenhausaufnahme erforderlich war.
Nach einem Klinikaufenthalt werden über tragbare Geräte
(Blutdruckmessgerät, Waage, EKG, Tablet) auf elektronischem Weg die
Informationen von zu Hause an die Schwerpunktpraxis als versorgende
telemedizinische Einrichtung übertragen, wo telemedizinisch geschultes
Fachpersonal die eingehenden Informationen prüft und bewertet und bei
Bedarf telefonisch berät. „Alle diese Komponenten einer engmaschigen und
in Teilen telemedizinisch ausgerichteten Versorgung im Rahmen von
Behandlungsnetzwerken ist zukunftsweisend für die Versorgung schwerkranker
Herzschwächepatienten“, betont der Herzstiftungs-Vorsitzende.
(wi)
Service zu den Herzwochen
Die Herzwochen stehen unter dem Motto „Stärke Dein Herz! Herzschwäche
erkennen und behandeln“ und richten sich an Patienten, Angehörige, Ärzte
und alle, die sich für das Thema Herzschwäche interessieren. An der
Aufklärungskampagne beteiligen sich Kliniken, niedergelassene Kardiologen,
Krankenkassen und Betriebe. Infos zu Patienten-Seminaren, Online-
Vorträgen, Telefonaktionen und Ratgeber-Angeboten (Text, Video, Podcast)
sind unter <herzstiftung.de/herzwochen> abrufbar oder per Tel. 069
955128-400 zu erfragen.
Neuer Ratgeber zur Herzinsuffizienz
Für Patienten mit einer Herzschwäche, Angehörige und Interessierte bietet
die Deutsche Herzstiftung den neuen Ratgeber „Stärke Dein Herz!
Herzschwäche erkennen und behandeln“ an. In der Broschüre (152 S.)
informieren renommierte Herzspezialisten leicht verständlich und
ausführlich darüber, wie eine Herzschwäche entsteht und was heute mit
Medikamenten, Interventionen und Sport therapeutisch erreicht werden kann,
um Lebensqualität und Lebenszeit zu verbessern. Die kostenlose Broschüre
kann telefonisch (069 955128-400), online (<herzstiftung.de/bestellung>)
oder per E-Mail (<
angefordert werden.
- Aufrufe: 194