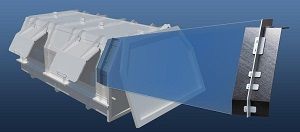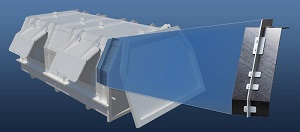Bessere Plug-in-Hybrid Fahrzeuge können Arbeitsplätze retten und dem Klima helfen!

• Clevere Auslegung von Batterie und Antriebsmotoren ermöglichen
hohe elektrische
Fahranteile
• Uneingeschränkte Reichweite bei begrenzter Batteriegröße bleibt
für viele Fahrer*innen
und Produzenten attraktiv
• Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) sichern Beschäftigung als Teil der
Übergangsphase
zur E-Mobilität
Heilbronn, Oktober 2020. Hermann Koch-Gröber, Professor für
Antriebstechnik an der Hochschule Heilbronn legt zusammen mit Thomas
Poreski, technologiepolitscher Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, und
Kai Burmeister, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Baden-Württemberg
einen Lösungsvorschlag für zwei wichtige gesellschaftlichen
Herausforderungen vor:
Wie kann unser Klima rasch wirksam geschützt und die zahlreichen
Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie gesichert werden?
Die Partner sind sich einig: eine neue Generation von Hybridautos mit
längeren elektrischen Reichweiten verringern CO2-Emissionen und sichern
gleichzeitig Arbeitsplätze. Heute verfügen viele Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
über stärkere Verbrennungsmotoren als Elektronatriebe, der das Fahrzeug
nur maximal 50 Kilometer weit bringt. Schon mittlere Fahrstrecken, aber
auch viele Beschleunigungen werden mit Benzin oder Diesel gefahren.
Eine klügere Auslegung von Batterie und Verbrennungsmotor könnte weitaus
mehr Emissionen einsparen. Zudem seien diese Fahrzeuge deutlich
attraktiver für Kunden, die nicht nur Kurzstrecken, sondern die Vielfalt
längerer Fahrten auch umweltschonend zurück legen wollten. Zum Beispiel
wird der Arbeitsweg verlängert, indem man einkaufen fährt oder Mitfahrende
abholt.
Ziel seien Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit effektiver elektrischer Reichweite
von 100 km. Ein kräftiger E-Motor werde von einem PS-ärmeren
Verbrennungsmotor unterstützt, der typischerweise nur im Fernverkehr wie
auf Autobahnen zum Einsatz kommt.
„Diese Fahrzeuge sind voll langstreckentauglich. Viele Nutzer können über
90 Prozent ihrer üblichen Strecken rein elektrisch zurücklegen. Sollten es
doch mal mehr als 100 Kilometer werden, springt der Verbrennungsmotor ein.
Die neuen Plug-in-Hybride sind also für jene vielen Kunden interessant,
für die ein Umstieg auf ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug bis auf
Weiteres nicht infrage kommt. Dafür sind keine kompletten
Neuentwicklungen nötig, bisher angebotene Plug-in-Hybride sind aber
unzureichend!“, sagt Koch-Gröber.
--
Hochschule Heilbronn – Kompetenz in Technik, Wirtschaft und Informatik
Mit ca. 8.200 Studierenden ist die Hochschule Heilbronn eine der größten
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg.
Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Technik, Wirtschaft und
Informatik. An vier Standorten in Heilbronn, Heilbronn-Sontheim, Künzelsau
und Schwäbisch Hall bietet die Hochschule mehr als 50 Bachelor- und
Masterstudiengänge an. Die Hochschule pflegt enge Kooperationen mit
Unternehmen aus der Region und ist dadurch in Lehre, Forschung und Praxis
sehr stark vernetzt.
- Aufrufe: 208