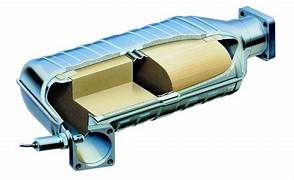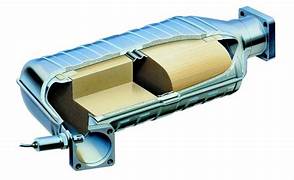Wie Zürichs Strassen aussehen müssten, damit mehr E-Bikes als Autos fahren
Was passiert, wenn Städte ihren Strassenraum in erster Linie auf den
Bedarf beim Radfahren und E-Biken ausrichten? Auf einer neuen,
populärwissenschaftlichen Website zeigen ETH-Forschende an Beispielen aus
der Stadt Zürich, wie eine solche E-Bike-City dereinst aussehen könnte.
Wie sähe der Strassenraum aus, wenn eine Stadt die Hälfte ihrer
Verkehrsflächen fürs Radfahren und E-Biken zur Verfügung stellte?
Benutzten Städter:innen dann häufiger ihr Rad? Wäre die E-Bike-City gar
ein Ansatz, um die verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu senken?
Diese Fragen untersuchen neun Professuren der ETH Zürich und der EPF
Lausanne seit gut anderthalb Jahren. Den Lead dieser Forschungsinitiative
hat der Verkehrsforscher Kay Axhausen, der im Januar 2024 emeritiert wird
(vgl. Box). Jetzt liegen die ersten Erkenntnisse vor, und die Forschenden
haben ihre Lösungsansätze anschaulich mit Visualisierungen aufbereitet und
diese Woche auf einer Storymap-Website veröffentlicht. Mittels
Storymapping lässt sich die Vision der E-Bike-City leicht verständlich
als Geschichte in Text und Bild nachvollziehen.
Die E-Bike-City-Vision sieht vor, dass die Menschen künftig die Hälfte
des städtischen Strassenraums nutzen können, wenn sie zu Fuss unterwegs
sind oder per Fahrrad, E-Bike, Lastenrad, E-Scooter oder mit anderen
Kleinverkehrsmitteln (sog. Mikromobilität). Heute sind über 80 Prozent des
städtischen Strassenraums für Autos und Parkplätze reserviert. Nur rund
11,7 Prozent sind für E-Bikes und Fahrräder vorgesehen. Zumeist teilen
sich Radfahrende und E-Biker:innen die Strassen mit den Autos.
Mehr Raum für die Menschen statt für die Autos
Im Unterschied dazu wären die Fahrspuren für Autos, öffentlichen Verkehr
(Trams, Busse), Zweiräder (Velos, E-Bikes) sowie die Gehwege für
Fussgänger:innen in der E-Bike-City grundsätzlich voneinander getrennt.
Dafür müsste kein zusätzlicher Strassenraum neu gebaut werden, sondern der
bestehende würde umgebaut. Das innerstädtische Autostrassennetz bestünde
in der E-Bike-City weitestgehend aus einspurigen Einbahnstrassen. Die
Fahrspuren für die Räder und E-Bikes befänden sich in der Regel links und
rechts der Einbahnstrasse. Der öffentliche Verkehr wiederum führe weiter
auf den bestehenden, separaten Fahrspuren. «Eine derartige Neugestaltung
gäbe den Menschen mehr Raum zurück», sagt Kay Axhausen.
Um die Neuerungen der E-Bike-City so realistisch wie möglich
darzustellen, haben die Forschenden drei typische Beispiele aus der Stadt
Zürich ausgewählt: Das Bellevue und die Quaibrücke beim Zürichsee, die
Birchstrasse in Zürich-Nord und die Winterthurer-/Letzistrasse in
Zürich-Oberstrass. An diesen Beispielen zeigen sie, wie ein Strassenraum
aussähe, wenn er rad- statt autofreundlich gestaltet wäre. Mit einem
Bildschieberegler lassen sich der heutige Strassenraum und der mögliche
zukünftige Zustand direkt miteinander vergleichen.
Der Entwurf der E-Bike-City folgt bestimmten Gestaltungsprinzipien:
Ausgehend vom bestehenden Strassennetz wird jeweils die eine Hälfte jeder
Strasse zu einer sicheren und komfortablen Fahrradstrasse umgebaut, die
mit dem Rad, Elektrorad, Lastenrad, Elektrotretroller etc. befahren wird.
Die andere Hälfte der Strasse dient nach wie vor den Autos (Benzin oder
Batterie), sodass die Zufahrt zu Wohn- und Bürogebäuden gewährleistet
ist.
In vier Schritten zum E-Bike-freundlichen Bellevue
Auf ihrer Storymap-Website zeigen die ETH-Forschenden am Beispiel des
Zürcher Bellevues und der Quaibrücke, wie sich die E-Bike-City-Prinzipien
in vier Schritten realisieren liessen:
Schritt 1: Der öffentliche Verkehr, der die Quaibrücke heute auf einer
Fahrspur in der Mitte überquert, behält seinen Vorrang. Die meisten
Tramgleise und Busspuren bleiben unverändert. Dort, wo keine separaten
Tram- und Busspuren möglich sind, sorgen gemeinsame Fahrspuren mit den
Autos für ein durchgängiges ÖV-Stadtnetz.
Schritt 2: Das Strassennetz der Autos erschliesst jedes Gebäude, sodass
alle wichtigen Zufahrten (z.B. Handwerker:innen, Menschen mit Mobilitäts-
oder Körperbehinderungen), Notdienste (Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei)
und Lieferungen möglich sind.
Schritt 3: Der verbleibende Strassenraum wird für die Mikromobilität
genutzt sowie für breitere Fusswege und neue Grünflächen. 37 Prozent der
heutigen Strassen in Zürich liessen sich laut den ETH-Forschenden für die
Mikromobilität, Gehwege und Grünflächen umnutzen.
Schritt 4: Je mehr Städter:innen sich in der Folge für ein autofreies
Leben entschieden, umso mehr Parkplätze liessen sich nach und nach zu
Fahrradabstellplätzen, Grünanlagen, Spielplätzen umbauen. Ein
ausreichendes Angebot an Ladezonen und Kurzzeitparkplätzen sicherte die
Zufahrten für Notfall-, Liefer- und Transportfahrzeuge.
Dynamische Strassennutzung gegen Staus
Neben diesen Schlüsselmassnahmen untersuchen die ETH- und
EPFL-Forschenden weitere Begleitmassnahmen. Zum Beispiel könnte die
Umstellung auf ein städtisches Einbahnstrassennetz die Autos stauen. Diese
Stau-Wahrscheinlichkeit liesse sich mit einer dynamischen Strassennutzung
senken. Dabei würde je nach Tageszeit mittels Lichtsignalen gesteuert, in
welcher Richtung die Autos und Fahrräder jeweils die Strasse benutzten und
wie viele Fahrspuren sie nutzen könnten. Auch die Akzeptanz der E-Bike-
City wird untersucht. Zum Beispiel könnten sich Autofahrende benachteiligt
sehen, wenn der Radverkehr bevorzugt gefördert wird. «Im Forschungsprojekt
überprüfen wir, wie tragfähig und kostendeckend die Grundannahme und die
Prinzipien der E-Bike-City sind, und welche Voraussetzungen für einen
möglichen Umbau nötig sind», sagt Kay Axhausen.
«Mit Blick auf die Erderwärmung können wir in der Verkehrsplanung nicht
wie bisher weitermachen. Wir brauchen neue verkehrspolitische Ideen für
die Städte. Die E-Bike-City ist auch ein Modell, wie der Verkehr seine
Treibhausgasemissionen reduzieren kann», sagt Axhausen, «die E-Bike-City
soll zeigen, dass Fahrrad und E-Bike als Standardverkehrsmittel in der
Stadt dienen können. Unsere Vision ist es, dass die Stadt bequemer,
leiser, grüner und gesünder wird als heute.»
Originalpublikation:
https://ebikecity.baug.ethz.ch
- Aufrufe: 153