Die Kunst der Regeneration – so erholt sich der Körper nach dem Sport am besten
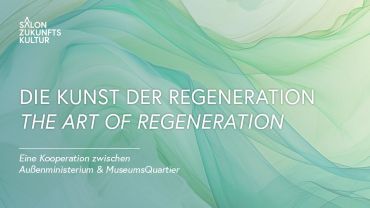
Ein gutes Training endet nicht mit dem Endspurt oder der letzten Wiederholung. Erst eine optimal genutzte Regenerationsphase macht den Körper leistungsfähiger. Wenn wir uns nach dem Sport bewusst erholen, geben wir unseren Muskeln die Möglichkeit, sich zu reparieren und zu wachsen. Erholung bedeutet dabei nicht Nichtstun.
- Aufrufe: 215