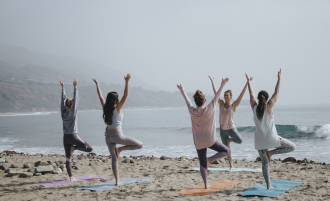Fasten und Rheuma: DGRh-Kommission nimmt Stellung zum therapeutischen Potenzial
Fasten gilt seit Jahrhunderten als gesundheitsförderlich. Für Erkrankungen
des rheumatischen Formenkreises liegen nur wenige Studien vor, die Effekte
des Fastens auf die Aktivität der Entzündung erfasst haben.
- Aufrufe: 206