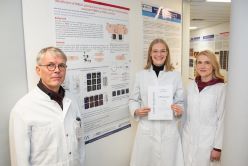Universitätsklinikum Dresden ist erneut nationales Topkrankenhaus
Focus Klinikliste zeichnet Kliniken und Fachbereiche der Hochschulmedizin
Dresden für 37 Indikationen aus. | Ergebnis belegt die hohe Expertise der
Dresdner
Medizinerinnen und Mediziner. | Patientinnen und Patienten profitieren von
interdisziplinärer Arbeit und Boards zum fachlichen Austausch über
individuelle Fälle.
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden nimmt erneut einen
Spitzenplatz im Reigen deutscher Krankenhäuser ein. Die Klinikliste des
Nachrichtenmagazins „Focus“ zeichnet den Maximalversorger als Top
Nationales Krankenhaus aus. In 37 von 58 analysierten Krankheitsbildern
wird die Expertise der Hochschulmedizin Dresden mit einer Erwähnung in den
Kliniklisten honoriert. Damit haben Patientinnen und Patienten, aber auch
einweisende Praxen einen Anhaltspunkt zur Behandlung unterschiedlicher
Indikationen. „Die Auszeichnung ist Beleg für unsere Expertise vor allem
in den Kernbereichen onkologische Erkrankungen, metabolische Erkrankungen
mit Schwerpunkt Diabetes sowie neurologische und psychiatrische
Erkrankungen. Hier arbeiten wir im engen Austausch mit der Forschung und
patientennah an innovativen Methoden zur Diagnostik und Therapie“, sagt
Prof. Uwe Platzbecker, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum. „Vielen Dank
an allen Mitarbeitenden und Teams in den unterschiedlichen Professionen.
Ohne deren Engagement wäre unser Erfolg nicht möglich“, ergänzt Janko
Haft, Kaufmännischer Vorstand.
Für die Erhebung wurden Daten aus öffentlichen Quellen, insbesondere die
gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichte, analysiert und die Kliniken
befragt. Ansprechpartner sind die Qualitätsmanagerinnen und -manager, die
Pflegedirektion sowie leitende Medizinerinnen und Mediziner aus den
Fachbereichen. In der Bewertung werden Fall- und Leistungszahlen,
Reputation, Pflege- und Medizinstandards berücksichtigt. „Klinikrankings
sind für uns wichtiger Gradmesser, um uns und unsere Qualität stetig zu
verbessern. Wir definieren uns nicht nur durch unsere Expertise und
moderne Ausstattung. Uns ist auch daran gelegen, dass sich die
Patientinnen und Patienten bei uns gut aufgehoben fühlen und wir sie
bestmöglich bei der Genesung begleiten“, sagt Prof. Uwe Platzbecker. Dabei
setzt das Uniklinikum auf interne und externe Audits sowie
Zertifizierungen und ein Bewertungssystem, das Patientinnen und Patienten,
Angehörige, Besuchende sowie Mitarbeitende berücksichtigt. „Die
Bewertungen sind uns extrem wichtig und hilfreich zugleich. Nur, wenn wir
wissen, wo es Kritik gibt, können wir konstruktiv darauf eingehen.
Natürlich freuen wir uns auch über Lob, das uns vielfach über diese Kanäle
erreicht“, sagt Janko Haft.
In diesen Bereichen wird das Universitätsklinikum als Top-Klinik gelistet
Die Focus Klinikliste recherchiert in 523 Krankenhäusern mit 1.808
Fachkliniken und gibt Empfehlungen für 58 Krankheitsbereiche in 14
medizinischen Oberkategorien.
• Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde: Hornhauterkrankungen,
Refraktive Chirurgie und Katarakt
• Medizinische Klinik und Poliklinik III: Akutgeriatrie, Diabetes,
Diabetische Fußerkrankungen
• Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe:
Kinderwunsch, Risikogeburt und Pränataldiagnostik, Krebserkrankungen an
Brust
• Klinik und Poliklinik für Dermatologie: Haut, Krebserkrankungen an
Haut
• UniversitätsCentrum für Orthopädie, Unfall- und Plastische
Chirurgie: Plastisch-Rekonstruktive Chirurgie
• Klinik u. Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie:
Gefäßchirurgie, Krebserkrankungen an Darm, Gallenchirurgie
• Klinik für Herzchirurgie, Herzzentrum Dresden: Herzchirurgie,
Kardiologie
• Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie: Kinderchirurgie
• Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin: Neonatologie,
Neuropädiatrie
• Klinik und Poliklinik für Urologie: Krebserkrankungen an Hoden,
Krebserkrankungen an Prostata sowie im lymphatischen System, Prostata-
Syndrom
• Medizinische Klinik und Poliklinik I: Krebserkrankungen an
Knochen, Krebserkrankungen an Lunge, Leukämie
• Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie: Hirn-Tumoren
• Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: Kopf-
Hals-Tumoren
• Klinik und Poliklinik für Neurologie: Demenzen, Parkinson,
Schlaganfall
• UniversitätsCentrum für Orthopädie, Unfall- und Plastische
Chirurgie: Hüftchirurgie, Unfallchirurgie, Depressionen
• Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik: Angst- und
Zwangsstörungen, Schmerzstörungen
• Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychothera
Essstörungen
• Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin: Nuklearmedizin
• Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie:
Strahlentherapie
• Poliklinik für Parodontologie: Zahnheilkunde
• Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik: Zahnheilkunde
- Aufrufe: 202