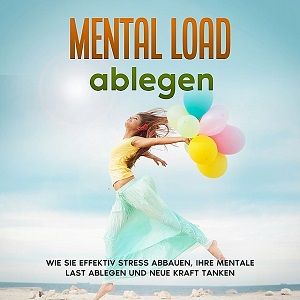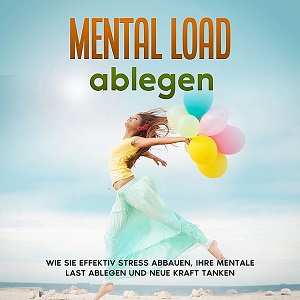Neue Hypertonie-Leitlinien: Was bedeuten sie für die Bluthochdruck- Behandlung?
Zielwerte, individuelles Risikoprofil, Krankheitsstadium: Herzstiftungs-
Experte ordnet Neuerungen der neuen Leitlinien für Betroffene mit
Bluthochdruck ein
Bluthochdruck ist einer der wesentlichen Risikofaktoren für Herz- und
Gefäßerkrankungen. So kann ein dauerhaft unzureichend oder nicht
behandelter Bluthochdruck zu Herzerkrankungen wie Herzschwäche und
Vorhofflimmern oder zu schwerwiegenden Komplikationen wie Gehirnblutung,
Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenversagen führen. Über 20 Millionen
Menschen haben in Deutschland einen hohen Blutdruck, etwa jeder dritte
Erwachsene. Zwar ist die gesundheitliche Gefahr, die von dauerhaft
erhöhten Werten ausgeht, hinlänglich bekannt. Dennoch ist die Zahl derer,
die ihren Blutdruck kontrollieren und ihre Werte kennen, vergleichsweise
gering. In Deutschland schätzen Experten, dass das etwa bei jedem fünften
Erwachsenen der Fall ist. Neue Leitlinien der Europäischen Gesellschaft
für Hypertonie (ESH) [1], die im Juni 2023 vorgestellt wurden,
berücksichtigen die individuellen Aspekte einer Hochdrucktherapie, z. B.
die Einteilung nach Krankheitsstadien des Bluthochdrucks oder eine
Vereinfachung der Blutdruckzielwerte, die es den Patienten erleichtert,
therapeutische Maßnahmen für ihren Schutz vor Komplikationen besser
nachzuvollziehen und zu akzeptieren. „Das ist wichtig. Denn zum einen
verursacht Bluthochdruck zunächst einmal keine Beschwerden, Stichwort
,stiller Killer‘. Zum anderen, sind Patienten oft verunsichert, wenn sie
die Diagnose Bluthochdruck erhalten“, betont Prof. Dr. Thomas Voigtländer,
Vorstandsvorsitzender der Herzstiftung und Ärztlicher Direktor des
Agaplesion Bethanien-Krankenhauses Frankfurt am Main, in einer Einordnung
der neuen Hypertonie-Leitlinien unter https://herzstiftung.de/leitli
hypertonie-2023 „Die neuen Leitlinien geben konkrete Antworten auf häufige
Fragen wie: Ab welchen Blutdruckwerten sollte ich tatsächlich Medikamente
nehmen? Und auf welchen Wert muss mein Blutdruck möglichst sinken, damit
das Herz effektiv geschützt ist?“
Pragmatische Zielsetzung erleichtert die Kommunikation
Insgesamt ähneln die neuen Empfehlungen den bisherigen. Doch die
Blutdruckzielwerte wurden zum Beispiel vereinfacht. Ganz pragmatisch gilt
nun offiziell die Empfehlung, dass jeder Patient, jede Patientin im Alter
zwischen 18 und 79 Jahren auf Werte unter 140 mmHg systolisch und 90 mmHg
diastolisch (mmHg: Millimeter-Quecksilbersäule) eingestellt werden sollte.
Diese Empfehlung gilt auch für Patienten über 80 Jahre, wenn das vertragen
wird. Denn damit könnte die bluthochdruckbedingte Gesundheitsgefahr
insgesamt deutlich verringert werden, betonen die Leitlinien-Autoren. Die
Empfehlung kommt somit der Behandlungsrealität nahe und dient als eine Art
Zielkorridor, der Anpassungen an die individuelle Situation eines
Patienten durchaus zulässt. Denn das heißt nicht, dass niedrigere Werte
nicht gut wären. Als bestätigt gilt ein Bluthochdruck im Allgemeinen, wenn
bei mindestens zwei bis drei Praxisbesuchen in Abständen von ein bis vier
Wochen erhöhte Werte ab 140/90 mmHg vorliegen oder eine deutliche
Blutdruckerhöhung (≥180/110 mmHg) beziehungsweise hohe Werte bei bereits
bekannter Herzerkrankung.
Eine Senkung auf Werte unter 130/80 mmHg ist in der Regel mit noch
besseren Therapieergebnissen verbunden, vor allem bei Patienten mit
bereits bestehender Herzerkrankung – ist aber für manche Patienten auch
mit unerwünschten Effekten verbunden. Schwindel oder verstärkt
Nebenwirkungen der Blutdrucksenker bei intensiver Therapie sind möglich.
„Das bestätigt, was auch die Deutsche Herzstiftung immer geraten hat. Eine
Blutdrucktherapie nutzt nur, wenn sie auch vom Patienten vertragen wird
und die Medikamente regelmäßig eingenommen werden“, so Prof. Voigtländer.
„Wichtig ist auch, dass klargestellt wird: Werte unter 120/70 mmHg sollten
bei einer Blutdrucktherapie vermieden werden.“
Bei Hochbetagten mehr Spielraum für Therapiebeginn – „individuelle
Entscheidung“
Für Patienten über 80 Jahre gilt entsprechend der neuen Leitlinien eine
spezielle Empfehlung: Während generell eine medikamentöse Therapie ab
einem beim Arzt gemessenen durchschnittlichen systolischen Wert über 140
mmHg und einem diastolischen Blutdruckwert über 90 mmHg ratsam ist, kann
bei den Älteren auch ein systolischer Wert bis 160 mmHg toleriert werden.
Zielwert ist dann ein systolischer Blutdruck wenigstens zwischen 140-150
mmHg, er darf aber auch niedriger sein. Vorsicht ist dann geboten, wenn
bereits sehr niedrige diastolische Werte unter 70 mmHg vorliegen. „Die
Entscheidung, ab welchem Blutdruck bei Hochbetagten mit einer Therapie
begonnen wird, ist immer eine individuelle Entscheidung. Dabei spielen vor
allem die allgemeine Gebrechlichkeit und weitere Begleiterkrankungen eine
wichtige Rolle“, erläutert Voigtländer. Ebenfalls wichtig: Eine schon
früher begonnene Blutdrucktherapie sollte auch bei Hochbetagten möglichst
fortgesetzt werden.
Medikamente: Kombinationstherapie effektiver als Monotherapie
Die Empfehlungen zur medikamentösen Therapie sind im Wesentlichen
unverändert. „Eine Zweierkombination aus ACE-Hemmer oder Sartan plus
Kalziumantagonist oder Diuretikum ist hier in der Regel der erste Schritt
zur Blutdrucksenkung“, erläutert der Frankfurter Kardiologe. Reicht das
nicht, sollte eine Dreierkombination aus diesen Wirkstoffklassen versucht
werden. Auf der dritten Stufe kommen weitere Substanzen ins Spiel. Wie
bisher sind die Aldosteron-Antagonisten (Spironolacton/Eplerenon) als
wichtige Substanzklasse bei der Behandlung der schwer einstellbaren
Hypertonie genannt. Neu ist bei diesen Patienten der Einsatz des
Kombinationspräparates aus Neprilysinantagonist und Sartan (ARNI,
Angiotensin-Receptor-Neprilysi
Blutdrucksenkung. Wenn dieses Kombinationspräparat eingesetzt wird, müssen
allerdings der ACE-Hemmer beziehungsweise das Sartan aus der bisherigen
Therapie abgesetzt werden. Bei Patienten, die bereits Nierenschäden
aufweisen, wird die Therapieempfehlung zudem um Wirkstoffe aus der Gruppe
der sogenannten SGLT-2-Inhibitoren (Gliflozine) ergänzt wie Empagliflozin.
„Wir haben inzwischen ein neues Verständnis, wie der Bluthochdruck
reguliert wird beziehungsweise durch eine Funktionsstörung aus vielen
Mechanismen entsteht, bei der verschiedenste Faktoren ineinandergreifen.
Das erklärt auch, warum wir mit der Kombination von Medikamenten, die ganz
unterschiedlich wirken, den Blutdruck viel effektiver senken können als
durch eine Monotherapie“, so Voigtländer.
Bei Patienten mit niedrigem bis mittlerem kardialen Risiko und mit einem
Blutdruck im hohen Normalbereich (130-139 mmHg systolisch und 85-89 mmHg
diastolisch) besteht die Empfehlung, keine blutdrucksenkende medikamentöse
Therapie einzuleiten. Bei diesen Patienten sollte sich die Intervention
vorerst auf eine Lebensstilberatung beschränken.
Regelmäßige Blutdruckmessung kann Hypertonie aufdecken
„Zu begrüßen ist auch, dass in den Leitlinien nochmals auf die Wichtigkeit
einer regelmäßigen Blutdruckkontrolle verwiesen wird. So wird betont, dass
bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf das Vorliegen eines
Bluthochdrucks gescreent werden sollte“, so der Herzstiftungs-Vorsitzende.
„Bei Menschen über 40 Jahren heißt das: Lassen Sie sich einmal pro Jahr
beim Hausarzt den Blutdruck checken.“ Risikopatienten wird dieses Vorgehen
bereits in jüngeren Jahren empfohlen. Hier werden in den neuen Leitlinien
auch Frauen nach der Menopause und Frauen mit einer Vorgeschichte von
Schwangerschaftsbluthochdruck und Schwangerschaftskomplikationen wie einer
Präeklampsie hervorgehoben.
Voigtländer rät: „Wer an sich gesund ist und nicht zum Hausarzt muss,
sollte zumindest die Gelegenheit nutzen, sich immer mal wieder in der
Apotheke den Blutdruck messen zu lassen. Das kann ebenfalls einen Hinweis
auf einen bisher unentdeckten Bluthochdruck liefern.“ Je früher ein
Bluthochdruck entdeckt wird, desto besser lassen sich die genannten Folgen
für Herz und andere Organe wie Gehirn und Nieren vermeiden.
Neue Stadieneinteilung anhand von Organschäden
Sinnvoll ist ebenfalls, dass neben der bisherigen Einteilung nach
Blutdruckwerten (z.B. optimal, normal, hochnormal) drei Krankheitsstadien
des Bluthochdrucks systematisch hervorgehoben werden. „Denn damit lassen
sich besser die fortschreitenden Schäden an Organen wie Herz, Hirn und
Nieren bei einem unbehandelten Bluthochdruck vor Augen führen“, wie Prof.
Voigtländer betont. „Wir möchten Patienten im Gespräch keine Angst machen.
Dennoch unterschätzen viele die Folgen ihres Bluthochdrucks – bis es zu
spät ist und zum Beispiel ein Herzinfarkt eingetreten ist oder die Nieren
schwer geschädigt sind“, so der Kardiologe. Das ist die Einteilung:
- Stadium I: unkomplizierte Erkrankung, bei der noch keine merklichen
Organschäden vorliegen (gilt auch bis zu einer Nierenerkrankung Grad 1 und
2)
- Stadium II: leichte Organschäden sind erkennbar, etwa der Beginn einer
chronischen Nierenerkrankung (Grad 3), oder das zusätzliche Vorliegen von
Diabetes mellitus
- Stadium III: es liegen bluthochdruckbedingte kardiovaskuläre
Erkrankungen vor oder eine fortgeschrittene chronische Nierenerkrankung
(Grad 4 und 5)
„Die Stadieneinteilung kann in der Kommunikation helfen, dass Betroffene
die Notwendigkeit von Lebensstiländerungen und gegebenenfalls einer
medikamentösen Behandlung verstehen und akzeptieren“, so der Kardiologe
und Intensivmediziner.
(ne)
Service-Tipp:
Bluthochdruck durch Schlafstörungen, Migräne und Lärm – Yoga und Kalium
als natürliche Senker? Was in den Hypertonie-Leitlinien noch neu und
wichtig ist, stellt der Herzstiftungs-Beitrag mit einer Experten-Einordung
durch Prof. Voigtländer unter https://herzstiftung.de/leitli
hypertonie-2023 vor.
Infos rund um Bluthochdruck bietet die Herzstiftung kostenfrei telefonisch
unter 069 955128-400, per Mail unter
der Homepage unter: https://herzstiftung.de/blutho
Video „Wie messe ich meinen Blutdruck richtig?“ mit Prof. Dr. Thomas
Voigtländer: https://www.youtube.com/watch?
Quelle:
[1] 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The
Task Force for the management of arterial hypertension of the European
Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA)
and the International Society of Hypertension (ISH). J Hypertens. 2023 Jun
21. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. Epub ahead of print. PMID:
37345492.
https://journals.lww.com/jhype
- Aufrufe: 89