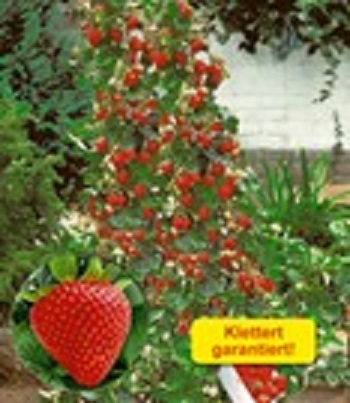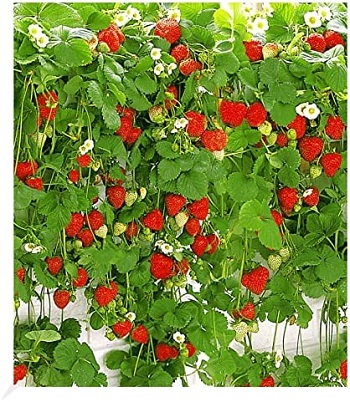Zürcher Kammerorchester Foto Harald Hoffmann
Besetzung und Programm:
Zürcher Kammerorchester
Daniel Hope Leitung und Violine
Sebastian Bohren Violine
Wolfgang Amadeus Mozart Adagio und Fuge c-Moll, KV 546
Arvo Pärt Tabula rasa
Alfred Schnittke Concerto grosso Nr. 3 für zwei Violinen, Streichorchester, Cembalo, Klavier und Celesta
Martin Wettstein The Temple of Silence. Konzert für zwei Violinen und Streichorchester (Uraufführung)
Edvard Grieg Aus Holbergs Zeit. Suite im alten Stil, op. 40
Begrüsst wurden wir durch die kaufmännische Leiterin des ZKO, Helene Eller, die einen gerafften Überblick über den aktuellen Konzertplan des Orchesters gab, etwas Rück – und auch Ausblick und dann das Wort an ihre Kollegin, der künstlerischen Leiterin, Lena – Catharina Schneider übergab, die ein paar kurze Erläuterungen zu den Werken dieses Konzertabends gab.
Wolfgang Amadeus Mozart Adagio und Fuge c-Moll, KV 546

- Helene Eller

- Lena-Catharina Schneider
Ein typischer Mozart dieses musikalische «Amuse d’oreille». Die Kopplung eines freien, expressiven Adagios mit einer Fuge für Streicher war in der Berliner Schule weit verbreitet, also nicht etwa aus der Wiener Klassik erwachsen, wobei Kaiser Joseph II. dieses Genre sehr schätze und Mozart ihm wahrscheinlich bedeuten wollte, dass er das Komponieren einer Fuge zumindest ebenso gut beherrschte wie des Kaisers Hofkomponisten Albrechtsberger und Salieri, die darauf spezialisiert waren.
Schon in dieser Fuge spiegelt sich Mozarts Kühnheit

Daniel Hope Violine und Leitung Foto Ansgar Klostermann
Schon jenes „kurze Adagio“ ist Mozart kühn genug geraten, trotz der äußerlich „barocken“ Gestalt mit punktierten Rhythmen und pathetischen Gebärden. Im Detail herrscht hier jene radikale Konsequenz der Stimmführung, wie er sie in den Jahren 1787/88 entwickelte. Dazu passt wiederum kongenial die Fuge, ein Extrem an Chromatik, wie es selbst Mozart kein zweites Mal geschrieben hat, im Übrigen die einzige vollendete der vielen Klavierfugen, die er 1782/83 studienhalber für den Baron van Swieten begonnen hatte.
Die Damen, hauptsächlich rot gekleidet und die Herren des Orchesters im gewohnten Schwarz, starteten beschwingt, sicht – und hörbar, voll motoviert in den Konzertabend, von Chef Daniel Hope souverän durch die Partitur geführt.
Nach dem langenanhaltenden Applaus richtete auch Daniel Hope ein paar Worte an die Besucher im praktisch ausverkauften grossen Tonhalle Saal.
Arvo Pärt “Tabula rasa”
«Tabula Rasa“ ein Geniestreich, eine Wegmarke der zeitgenössischen Moderne von Pärt. Nach einem achtjährigen Sabbatical, einer Auszeit, die er dem Studium mittelalterlicher Musik, der Gregorianik und der Renaissance-Polyphonie widmet, findet er 1976 zum Komponieren zurück: Er hat die Lösung für sich selbst in einem gleichsam musikalischen „Zurück zur Natur“ gefunden, in einem Kloster komponiert.

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Synchrones Intro der beiden Violinen bevor sich leise die anderen Streicher dazu schleichen, aber gleich wieder, diesmal abwechselnd von den beiden Violinen «überflogen» werden, alles in eher düsteren, nachdenklichen Notenbögen, fein austariert durch Sebastian Bohren und Daniel Hope und irgendwie fast bestaunt durch ihre Mitmusiker*innen, die je nach dem, auch ins Geschehen eingreifen. Etwa nach der Hälfte der Komposition, hat Arvo Pärt eine längere Orchestersequenz eingefügt, bevor wieder die beiden Solisten in den Vordergrund treten.
Laute Glocke erinnert an die Stille

Das Tintinnabulum links aussen kam heute Abend zum Erklingen bei Pärts tabula rasa
Die zwischendurch immer mal ertönenden Schläge auf dem «Tintinnabulum», einer Art Stangenglocke, erinnert an die Glockenschläge während des Komponisten Aufenthalt im Kloster. Das mit einem roten Filzhammer geschlagene Röhrenglockenspiel setzte dazwischen immer wieder markante Akzente
Gegen Ende eine eigentliches «fade out» das man sonst nur in der Popmusik kennt, in diesem Fall ein zunehmend sanftes Ausstreichen der Töne durch das Cello ins Nirgendwo, bei Pärt wohl in die Stille des Klosters, seinem selbstgewählten temporären Exil.
Das Auditorium zeigte sich tief bewegt ob der hingebungsvollen Interpretation durch die Protagonistinnen und geizte nicht mit dementsprechendem Applaus.
Stilbildend auch für andere Musikgenres

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Welche Bedeutung andere Musiker dem Werk beimessen belegt u.a. die Tatsache, dass einer der bekanntesten Jazzpianisten unserer Zeit, Keith Jarrett, das Werk zusammen mit dem Staatsorchester Stuttgart, den 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, dem Lithuanian Chamber Orchestra und Violinist Gidon Kremer auf CD verewigte.
Alfred Schnittke Concerto grosso Nr. 3 für zwei Violinen, Streichorchester, Cembalo, Klavier und Celesta
Der 1934 geborene russisch/deutsche Komponist Alfred Schnittke, der in den 50er Jahren am Moskauer Konservatorium studierte und später dort auch unterrichtete, hatte in der damaligen Sowjetunion einen schweren Stand als Komponist und gewann seine Popularität zunächst im Westen, etwa mit den Aufführungen seines 1. “Concerto Grosso” für zwei Violinen, Cembalo, Präpariertes Klavier und Streicher, das 1977 entstand. Zwei Jahre später komponierte er sein Konzert für Klavier und Streicher.
Alfred Schnittkes Komposition Concerto grosso Nr. 3 ist im besten Sinne extrem gespenstisch. Introvertiert und in gleichem Maße explosiv erscheint dieses, da ohne eigentliche Satzbezeichnung, einsätzige Sonate, deren innere Struktur nur noch die morschen Überreste der Sonatensatzform bestimmt. Dissonante Schock-Stöße beenden erstickende Kantilenen und beschwören einen nervösen Totentanz herauf, während eisige Tremolo-Splitter des Klaviers in einen voll-pedalisierten Malstrom stürzen. Zuletzt durchschießt der schicksalshafte Akkord, der das Stück immer wieder heimsucht, aggressiv das bittersüße Lamento.
Snittkes immense Mannigfaltigkeit

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Um diese Mannigfaltigkeit zu bannen, entwickelte Schnittke seine polystilistische Schreibart: ein Miteinander verschiedener Stilebenen ein parodistisch anmutendes Umspringen zwischen Nähe und Ferne, Höhe und Tiefe, Dichte und Auszehrung. All dem liegt die Vorstellung einer kreisenden Zeit zugrunde, die Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges verschmilzt.
Ich möchte erwähnen, dass alle Antiquitäten in meinen Stücken
von mir nicht gestohlen, sondern gefälscht wurden“, sagte Alfred Schnittke einmal. So zitierte er in diesem Werk einige grosse Komponisten die entweder im Geburts- oder im Todesjahr die Zahl 85 haben. Wie z.B. J.S. Bach, G.F. Händel, und Domenico Scariatti alle geb. 1685, Alban Berg geb 1885, Gábor Darvas, Paul Creston und Reinhard Schwarz – Schilling, alle gest. 1985 usw.

Heinrich Schütz, porträtiert von Christoph Spätner, um 1660
Schnittke tat dies aus folgendem Grund: Es war die Auftragskomposition der damaligen DDR zur Feier des 300sten Geburtstag des Komponisten Heinrich Schütz. Der 1585 in Köstritz geboren wurde und 1672 in Dresden verstarb.

Konzertmeister Willi Zimmermann
Die Solisten und das Orchester spielten sich hervorragend durch die sehr anspruchsvolle Partitur, wobei Konzertmeister Willi Zimmermann sich ab und zu als Interimsdirigent betätigte.
Die Polistlistik als Markenzeichen
Schnittke selbst prägt für seine Kompositionstechnik den Begriff „Polystilistik“.
Aber das ist weit mehr als eine Technik oder ein Begriff: Es ist
ein ästhetisches Programm, ein ernsthafter Versuch, den Teufels-
kreis der nur noch sich selbst genügenden Avantgardemusik zu durchbrechen. „Die großen Figuren der Vergangenheit können nicht verschwinden … Ihre Schatten sind
lebensfähiger als das Pantheon-Gedränge von heute…“, hat Alfred Schnittke behauptet. Mit stilistischen Allusionen – hier im barocken Concertato-Stil – hat Alfred Schnittke einen Zusammenbruch der alten – oder vielleicht auch der aktuellen, weil im Museumsgefängniskasernierten Welt auskomponiert.
Der Ordnung halber hier doch noch die Auflistung der Sätze in dem eigentlich einsätzigen Werk
- Allegro
- Risoluto
- Pesante
- [Keine Tempovorgabe] (später als Adagio benannt)
- Moderato

Daniel Hope Violine und Leitung
In diesem Werk spielen der Cembalist, der Pianist und die beiden Geiger eine Doppelrolle, indem sie als Konzertsolisten wie auch »gruppenführend« auftreten. Das Concerto grosso wirkt wie ein veritables Violinkonzert mit zwei zur Hochform auflaufenden brillanten Solisten. Die mal ein Duett spielten, sich darauf förmlich gegenseitig durch die Partitur jagten, sodass sich daraus plötzlich ein veritables Duell entwickelte, schlicht atemberaubend.
Das sachkundige Auditorium wusste diese grossartige Performance mit den entsprechenden Applauskaskaden zu würdigen, bevor man sich in die Foyers zur Pause begab.
Martin Wettstein The Temple of Silence. Konzert für zwei Violinen und Streichorchester (Uraufführung)

Sebastian Bohren
Photo: Marco Borggreve
Auf dieses Auftragswerk des ZKO war das Auditorium natürlich besonders gespannt, zumal das «Tonhalle Publikum» doch eher als konservativ einzustufen ist.
Es waren dann teilweise auch sehr forsche Töne aber immer ausbalanciert mit feinzislierten Klangfinessen, mal furiose Tonexplosion, mal ganz fein ausgestrichen, progressiv und doch vertraut, erstaunlich, wie Wettstein variiert ohne den Zusammenhalt zu zerstören. .
Zur Entstehung des Werkes

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Eigentlich hätte er Sänger werden sollen. Herbert Crowley (1873–1937) verliess Lon-
don und begann in Paris bei einem berühmten italienischen Tenor zu studieren. Das
Lampenfieber machte den Traum zunichte, Crowley liess das Singen bleiben. Heute gilt Crowley als unverwechselbarer Zeichner
in den Anfängen des Comics, der ein Stern am New Yorker Kunsthimmel hätte werden können. 1913 war er mit zwei Bildern an der legendären Armory Show zusammen mit anderen europäischen Avantgardekünstlern vertreten. The Temple of Silence ist eine Kollektion streng symmetrischer Bilder von Tempelanlagen, eine Mischung aus Detailversessenheit und Mystik, die nach dem legendären Comic The Wigglemuch entstand. Sein Leben sei wie eine «lange dunkle Wolke, mit einem Lächeln zwischendrin», schrieb Crowley in sein Tagebuch in der
Zeit, als Carl Gustav Jung den Exzentriker in Küsnacht zu therapieren versuchte. Crowley hätte das Umfeld Jungs als «Psychosumpf» empfunden, sagt seine Nichte Susanna Wettstein Scheidegger und sie wiederum ist die Tante des Auftragskomponisten Martin Wettstein, der mit der Wiederentdeckung Crowleys im Jahr 2017dessen faszinierende Bildwelt kennenlernte. Die Spiegelsymmetrie ist ein zentrales Verfahren Crowleys und zeichnet auch The Temple of Silence aus. Wettstein greift in seinem gleichnamigen Konzert für zwei Violinen und Streichorchester dieses Verfahren verbindenden Faden zu zertrennen und lässt sich ausserdem von Arvo Pärts Tabula rasa und dessen Reduzierung auf wenige Mittel und ausgewogene Proportionen inspirieren. «Meine Musik soll Menschen von
heute berühren, gar begeistern», sagt Martin Wettstein, «und in ihnen selbst etwas in
Schwingung bringen.»

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Wettsteins Werk ist äusserst komplex, deshalb auch fast nicht möglich zu beschreiben, fehlen doch, natürlich bei einer Uraufführung, auch jegliche Vergleichsreferenzen, sei es in Form von Trailern oder Rezensionen, Kritiken usw.
Dem aufmerksamen Publikum aber gefielen die aussergewöhnlichen Töne und es spendete denn auch einen langanhaltenden, stürmischen Beifall.

Martin Wettstein
Zum Schluss gesellte sich auch noch Komponist Martin Wettstein zu den Musiker*innen und durfte einen grossen Extraapplaus für sein Werk geniessen.
Edvard Grieg «Aus Holbergs Zeit» Suite im alten Stil, op. 40
Erstaunlich liebliche, fast zärtliche Klänge im zweiten Konzertteil, die man von Norwegern, die man sonst eher als unterkühlt, spröde wirkend wahrnimmt, nicht unbedingt erwartet.
Grundsätzliches zur Entstehung
Jede europäische Nation hat ihre Symbolgestalt für den Spätbarock. Für die Franzosen ist es das Louis Quinze, die Epoche Ludwigs XV., für die Portugiesen die große Zeit des König Joao V., für die Deutschen die Bachzeit und für die Engländer die Ära des Premierministers Horace Walpole. In Norwegen ist es der Dichter Ludvig Holberg, den die gesamte Nation mit jener Zeit identifiziert. Der große Sohn der Stadt Bergen wurde 1684 geboren, ein Jahr vor Bach und Händel, und drückte als Philosoph, Dichter und Humorist der Epoche seinen Stempel auf.
Hommage zum 200sten Geburtstag eines grossen Norwegers

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO
Als seine Heimatstadt 1884 seinen 200. Geburtstag feierlich beging, trug der damals berühmteste Bewohner Bergens, Edward Grieg, mit einer Kantate für Männerchor und einer Klaviersuite zum Gelingen des Jubiläums bei. Auf einer Reise nach Berlin instrumentierte Grieg die Klaviersuite Aus «Holbergs Zeit «für Streichorchester. Es wurde eines seiner bis heute populärsten Werke, das er gleichwohl nicht mochte. Dennoch gilt die Suite neben den Streicherserenaden von Dvorak und Tschaikowsky als das dritte große Werk der Spätromantik für Streichorchester.
Norwegen à la «française»
Was Grieg hier mit den Mitteln des romantischen Streicherklangs wiederbelebte, war die spätbarocke Orchestersuite mit ihren französischen Tanzformen. Er benutzte vier der beliebtesten Barocktänze, Sarabande, Gavotte, Musette und Rigaudon, denen er ein Präludium voranstellte und eine Air beigab.
Beim Präludium erinnern aufsteigende Skalen im punktierten Rhythmus an die französischen Ouvertüren des Barock. Darauf folgt als erster Tanz Satz die langsame Sarabande, die hier aller barocken Erdenschwere beraubt ist und träumerisch-süß daherkommt, besonders im Mittelteil mit seiner Bratschen-Melodie. Die Gavotte dagegen verwandelt den typischen Zwei-Viertel-Auftakt dieses Tanzes in geradezu unverschämt gute Laune, und auch die folgende Musette, ein Tanz, der dem Dudelsack seinen Namen verdankt, ist an rustikaler Eingängigkeit nicht zu übertreffen.
Genau diese unverschämt gute Laune wussten die Damen und Herren auf der Orchesterbühne vollumfänglich auf das Publikum zu übertragen
Als lyrischen Kontrapunkt ließ Grieg eine Air in g-Moll folgen, einen melancholischen Gesang, den er als “religiöses Andante”, sprich: als Gebet bezeichnete. Zweifellos dachte er dabei an die Air aus der 3. Orchestersuite von Bach, das auch heute noch berühmteste Beispiel einer barocken Air.
Den delikaten Schlusspunkt setzt ein Rigaudon, ein schneller Tanz mit charakteristischem Auftakt aus Viertel-Zwei-Halben. Unter Griegs Händen verwandelt sich dieser Rhythmus in ein duftiges Rondo zu Pizzicato-Begleitung mit sanftem g-Moll-Mittelteil.
Das Orchester lief zur Hochform auf, begeisterte, verbreitete Wohlgefallen mit seinem freudvollen schwelgerischen Spiel.
Das Auditorium, begeistert vom grossartigen Spiel der Protagonist*innen, feierte diese mit einem langanhaltenden, nicht enden wollenden Schlussapplaus.
Dafür beschenkten uns die Zürcher noch mit einer rassigen Zugabe in Form des letzten Satzes «Alla Tarantella»: Prestissimo con fuoco von Erwin Schulhoff (1894-1942) aus fünf Stücke für Streichquartett (1923), die irgendwie Rimski Korsakows «Hummerflug» zitierte.

Die Proagonistinnen bedanken sich für den Applaus
Da auch hier der Applaus nicht enden wollte, bemerkte Daniel Hope, dass man uns hier behalten wolle und sie deshalb noch, mit dem Streichquartett a-Moll, ein äusserst anspruchsvolles Werk von Sir William Turner Walton spielen würden.
Fazit
Einmal mehr ein äusserst gelungener, beeindruckender Konzertabend beim ZKO in der grossartigen, von 2017 bis 2021 für ca. 175 Millionen Franken, total neurenovierten Tonhalle in Zürich.
Text: www.leonardwuest.ch
Fotos: www.zko.ch
Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch

Tonhalle-Zürich-grosser-Konzertsaal vor dem Konzert

Sebastian Bohren und Daniel Hope engagiert auf der Bühne auf der ViolineFoto von Linda Schürmann ZKO

Daniel Hope inmitten seines Orchesters Foto Sandro Diener

Hochkonzentriert am zuhören

Konzertmeister Willi Zimmermann

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO

Die Proagonistinnen bedanken sich für den Applaus

Konzertfoto von Linda Schürmann ZKO

Die Proagonistinnen bedanken sich für den Applaus