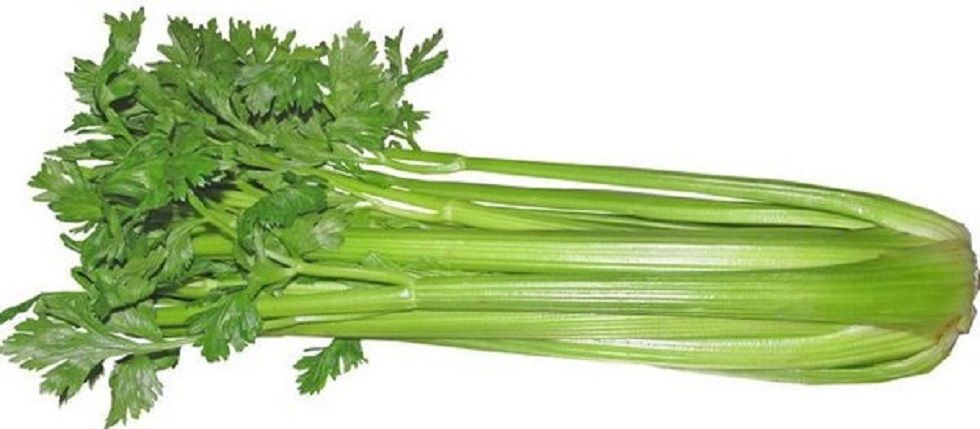Herbert Hubers Rezepturen zum Wochenende

Ein paar Rezepte von Gastronom und Autor Herbert Huber, die gar nicht so kompliziert sind zum nachkochen. Frisch gewagt ist schon halb gewonnen.
Wieder einmal ein Rezept – wer wagt gewinnt

Die lange Stangen Sellerievariante ist milder im Geschmack und knackiger als sein Knollen-Verwandter, dazu macht er auch weniger Rüstarbeit: Die hellen inneren Stangen muss man nur waschen, dann nach Rezept zuschneiden. Die äusseren dunkelgrünen Zweige haben an ihrer Aussenseite harte Fasern, die man wie beim Rhabarber abzieht oder mit einem Sparschäler entfernt. Zudem können die gelblich-zarten Herzblätter wie Petersilie verwendet werden. Das Gewicht der Stangenselleriestauden kann beträchtlich variieren und reicht von etwa 200 g bis weit über 800 g. Die würzigen Stangen schmecken auch roh sehr gut, zum Beispiel serviert mit Dipps auf Quarkbasis. Die fleischig-gerippten Stangen mit ihren aromatischen Blättchen an der Spitze schmecken hingegen feinwürzig, die gelblichen milder als die Grünen.
Im Gemüsefach des Kühlschranks hält sich das Gemüse problemlos eine gute Woche frisch. Sellerieblätter kann man wie Kräuter einfrieren und später für Salate, Suppen und Saucen verwenden.
Doch nun zu einem Rezept, welches bei uns oft gekocht wird. Stangensellerie Gratin mit bunten Rüebli.

Zutaten 600gr. Stangensellerie ca 5 cm geschnitten. Je 1 mittelgrosses gelbes, rotes und violettes Rüebli, geschält und gleich wie die Sellerie geschnitten. 1 Zwiebel, 2 Esslöffel Butter, 3dl Gemüsebouillon, Salz, Pfeffer schwarz, aus der Mühle.100 g Schinken dünn geschnitten. 3 dl Rahm. 100 gr Sbrinz gerieben, Paprika edelsüss
Zubereitung: In einer weiten Pfanne oder WOK die Butter schmelzen. Die Zwiebeln darin andünsten. Den Stangensellerie und die Rübli beifügen und kurz mitdünsten. Dann die Bouillon dazu giessen und das Gemüse zugedeckt nicht zu weich kochen (8-10 Minuten). Am Schluss mit Salz und Pfeffer würzen. Dann abschütten – 1 dl Kochflüssigkeit beiseitestellen.
Den Schinken in Streifen schneiden. Mit dem Gemüse mischen und in eine gut ausgebutterte Gratin Form geben. Das Selleriegrün hacken. Mit dem beiseite gestellten Sud, dem Rahm und den dem Sbrinz mischen und mit Salz, Pfeffer sowie Paprika würzen. Über die Gemüsemischung verteilen.
und im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen in der Gratinform auf der zweituntersten Rille etwa 20 Minuten überbacken. Dazu passt wunderbar ein Sauerteigbrot
Sollte es Resten geben – einfach alles fein mixen und als Suppe servieren.

Zum Schluss noch etwas Südländisches mit Stangensellerie:
Stangensellerie in ca 3 cm lange Stücke schneiden. In einer Pfanne wenig Wasser aufkochen. Sellerie mit Salz und Pfeffer würzen. Ca. 10 Minuten zugedeckt knackig dämpfen. 1 Schalotte hacken. Peperoni halbieren und in kleine Würfel schneiden. Oliven ohne Stein halbieren. Minze hacken. In einer Bratpfanne Öl erhitzen. Sellerie, Peperoni, Schalotte und Oliven ca. 2 Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Minze darüber streuen und servieren.
Geschichten rund ums Pastetli

Ich liebe Pastetli heiss. Aber nur dann, wenn diese auch heiss serviert werden. Vor allem in einer Wirtschaft sollte die Regel gelten: Der Gast wartet auf das Pastetli und nicht umgekehrt. Will heissen: Pastetli müssen zwingend à la minute angerichtet und im Eiltempo an den Tisch gebracht werden. Egal, was drin ist. Das Gehäuse muss noch knusprig sein – auf keinen Fall pampig. Pastetli kann man gut vorbereiteten.
Vol-au-vent.

Nicht zu verwechseln ist das Pastetli mit der Pastete, die mit einem Mürbeteig gemacht und mit einer „Farce“ gefüllt wird. Der französische Name des Pastetlis ist Vol-au-vent. Die Legende besagt, der französische Koch Marie-Antoine Carême habe einmal eine Pastete statt mit Pastetenteig mit Blätterteig zubereitet. Als sein Gehilfe nach der Pastete im Ofen sah, sei er erschrocken und habe gerufen: «Maître, il vole au vent» («Meister, sie fliegt in die Luft»), denn aus dem flachen Teig war eine turmartige Form entstanden. Das Pastetli war geboren.
Heute kann man Pastetli-Gehäuse bequem beim Hausbäcker kaufen, wobei es da qualitative Unterschiede geben kann. Mal abzuwechseln, kann sich lohnen. Wichtiger als das Haus ist aber in den allermeisten Fällen das Innenleben, die hausgemachte Füllung.
Chügeli und Fritschi – Letzteres das Urgericht der Lozärner Fasnächtler

Diskutierte man einst mit der Grande Dame der Schweizer Gastronomie, mit Marianne Kaltenbach, zog das eine nahezu endlose Unterhaltung nach sich. Vor allem dann, wenn es um die originale Luzerner Fritschi-Pastete ging. Marianne Kaltenbach kam ins Feuer der Begeisterung, wenn jemand wusste, dass diese mit einer braunen Sauce, mit Champignons, Kalbsbärtchügeli, Kalbsragout und Weinbeeren gefüllt und die Sauce mit etwas Madeira parfümiert wird. Mit diesem Wissen konnte man bei Madame gehörig punkten. Und gedeckt müssen diese Pasteten serviert werden, keinesfalls offen. Als wir einmal in einer Luzerner Wirtschaft
als Lozärner Fritschi-Pastetli ein hundskommunes Chügelipastetli vorgesetzt bekamen, zudem noch an einer weissen Sauce serviert, war Marianne trotz ansprechender Qualität des Servierten stocksauer. Zu Recht, wie ich finde. Ein Fritschi-Pasteli ist nun mal kein Chügelipastetli.
Zur Vorspeise
Als Vorspeise wurden sie auch „Bouchées“ genannt, weil sie etwas kleiner waren – oder zum
Hauptgang und eben etwas grösser als Vol-au-vents serviert wurden. Pastetli gab es als Festessen, an Sonntagen im Menü, an den Geburtstagen der Grosseltern und an Leidessen. Der Grund ist einfach: Pastell sind für eine Küche wunderbar, weil alles vorbereitet werden kann. Apropos Form: So serviere ich Pastetli mal rund, viereckig, sogar herz -oder sternförmig. Der Bäcker macht’s auf Vorbestellung.
Grundrezept für die Sauce: 60 gr. Butter. 4 EL Mehl. 1 dl Weisswein. 4dl. Fleischbouillon, Milch oder Gemüse Fond. 1dl Rahm. Salz und Pfeffer. Die Sauce sollte nie zu dünn sein, sonst saugt der Teig diese schnell auf und wird matschig. Zu dünn? Mit etwas Mehl Butter (beurre manié) oder Maizena nachbinden.
Ideen für die Füllung.
Für Vegetarier mit Gemüse oder Pilzfüllung. Oder gar mit einem würzigen Ratatouille.
Exotisch: Mit Poulet- und Gemüsewürfelchen an Currysauce. Für Krustentierliebhaber: Mit Krevetten, mit Muscheln oder mit einem würzigen Fischragoût. Edel: Mit Kalbfleisch, Milken, Champignons. Auch mit einem Pouletbrüstchen Ragoût mundet’s wunderbar. Oder einfach mit Brätchügeli.
Weitere Tipps: Die berühmten Teigdeckeli, die vor dem Aufwärmen der Pastetli rausgeschnitten wurden, nicht vergessen! Immer etwas Sauce separat servieren. Kreativ sind auch ein paar frittierte Randenscheiben oder im Ofen getrocknete Tomatenscheiben als Farbtupfer.
Hacktätschli à la Gertrude Huber
Zutaten:
Je 250 gr. gehacktes Kalbs-Rinds-Schweinsvoressen (mittlere Scheibe)
1 kl. Zwiebel fein gehackt
1 Knoblauchzehe fein gehackt
1 EL. gehackte Kräuter (Thymian, Petersilie, Oregano)
wenig gehackte Peperoncini (Achtung scharf)
1 altbackenes Weggli – Rinde entfernen, in kleine Würfel schneiden und in 1 – 1/2 dl. Milch einweichen. Gut zerdrücken und verrühren.
1 1/2 dl Weisswein
1 rohes Ei
Worcestershire Sauce (2-3 Spritzer)
Salz und Pfeffer
Feines Paniermehl
Zubereitung:

Ei und Weisswein in einer grossen Schüssel verrühren. Restliche Zutaten (ausser das Fleisch) beigeben und gut vermischen. Etappenweise Fleisch dazugeben und jeweils mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Mit eine grossen Gabel gut vermischen. Abschmecken.
Klarsichtfolie auslegen. Diese mit Paniermehl bestreuen. Mit der Gabel das portionierte Fleisch darauf legen und rund formen. Die Tätschli leicht mit Paniermehl bestreuen. Sorgfältig etappenweise im heissen Erdnussöl beidseitig anbraten. Je nach Grösse pro Seite etwa 2 Minuten.
Beilage:

Mit Kartoffelstock – Seeli servieren.
Für die Seeli Sauce:
-Schmorbraten Sauce eignet sich am Besten
-Sonst kann man auch auf eine „Convenience Sauce“ ausweichen – diese aber individuell persönlich abschmecken…
Szegediner Gulasch a la “Hueber” Familie

Gemüsezwiebel (ca. 300 g) 1 rote Paprikaschote1 gelbe Paprikaschote .Ca 500 gr. Sauerkraut
800 g gemischtes Gulasch (Rind und Schwein) 2 TL edelsüßes Paprikapulver 2 TL scharfes Paprikapulver 1 TL Kümmel (gemahlen) Pfeffer, Salz .150 ml Vollrahem 250 ml Gemüsefond . Kartoffeln.
Zubereitung:

Gemüsezwiebel fein würfeln. Paprika putzen und ca. 1 cm groß würfeln. Sauerkraut abgießen und abspülen. Alles mit dem Fleisch in einer großen Schüssel mischen. Mit 2 TlL Salz, je 1 TlL edelsüßem und scharfem Paprikapulver, In einen Bräter (ca. 30 cm Ø) geben. Den Ofen auf 190 Grad vorheizen (Umluft nicht empfehlenswert).

Rahm und Fond aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Über die Gulaschmischung geben. Zugedeckt im heißen Ofen auf der untersten Schiene 2 Std. garen. Dabei ab und zu umrühren und die letzten 30 min. offen garen. Gulasch evtl. mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kümmel nachwürzen. mit Petersilie bestreut servieren. Dazu passt ein Tupfer Sauerrahm. Und Salzkartoffeln.
Text www.herberthuber.ch
Fotos www.pixelio.de
Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch
- Aufrufe: 149