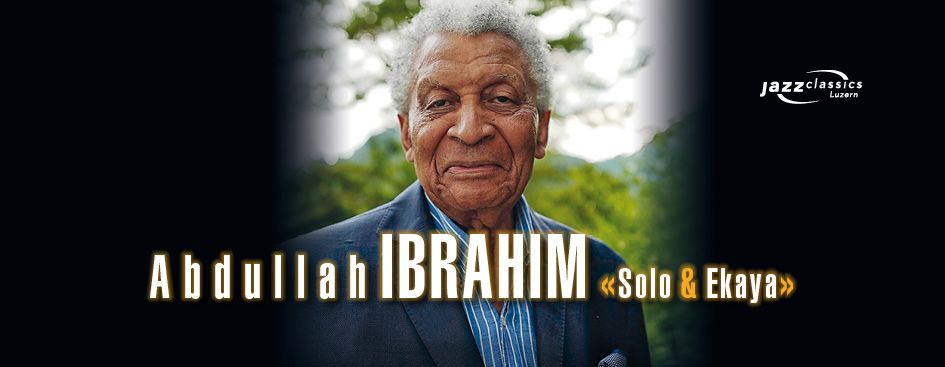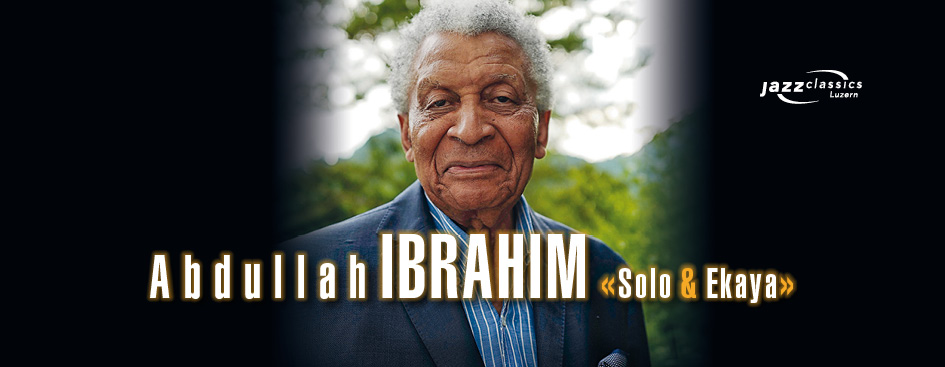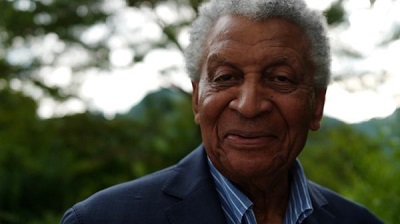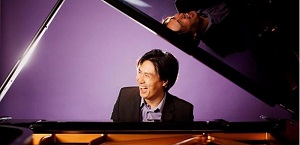Unsere Reise – wohin? von Anna Rybinski

Ballettabend mit Weltpremiere der Boston Ballet Company am 6. April 2023Our journey – Unter diesem Titel brachte das renommierte Boston Ballet seine neue Produktion heraus – eine seiner teuersten und aufwendigsten überhaupt. Nicht nur das Ensemble von 69 Tänzern und das hauseigene Orchester waren im Einsatz, auch eine Multimedia Show mit Lichtregie, Soundtracks, Videokompositionen, und sogar ein Frauenchor trugen zum Gesamtergebnis bei. Mit diesem riesigen Apparat wollte Boston Ballet nicht nur Unterhaltung bieten: Brennende Umweltprobleme kamen auf und weckten düstere Vorahnungen. Ungewohnt von einer Ballettkompanie, die sich meistens der Schönheit und der märchenhaften Fantasiewelt verschreibt.

Der Abend fing allerdings mit viel Lebensfreude an. Der erste Teil: Everywhere We Go, (Musik Sufjan Stevens, Choreografie Justin Peck) ist eine unterhaltsame, virtuose Parade in neun Szenen, die alle Register des weltberühmten Ensembles ziehen konnte. Die Musik wechselte zwischen romantischer Reminiszenz, jazzigen Einflüssen und Minimalismus: eine dankbare Partitur für abwechslungsreiche Szenen. Die Trikots waren französisch angehaucht, und im Hintergrund wechselten sich ruhige Bilder von geometrischen Formen ab, die die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen nicht ablenkten. Es war eine Augenweide.

Im zweiten Teil kam die mit Spannung erwartete Weltpremiere: die Choreografie von Nanine Linning zu Musik von Claude Debussy‘s La Mer. Der Komponist, der seine malenden Zeitgenossen, wie den französischen Monet, aber auch den Amerikaner Whistler und den Engländer Turner als Inspirationsquelle schätzte, konnte sich gar nicht darüber freuen, wenn man seine Musik impressionistisch nannte. Für uns unverständlich; wie könnte man seine schillernden, von Farben und Rhythmen vibrierenden Werke anders bezeichnen? „La Mer“ ist ein prächtiges Klanggemälde par excellence, mit allen möglichen Schattierungen der Orchestertöne ausgemalt – vom Meer inspiriert wie keine andere Komposition der Musikliteratur.Die drei Sätze wurden noch mit dem letzten Satz aus „Nocturnes“ (ebenfalls von Debussy) ergänzt: Die Sirenen. Die sinnvollste Ergänzung überhaupt, wenn es ums Meer geht! Die drei Sätze wurden noch mit dem letzten Satz aus „Nocturnes“ (ebenfalls von Debussy) ergänzt: Die Sirenen. So ergab sich in der Choreografie diese spezielle Reihenfolge:
-
- Von der Morgendämmerung bis zum Mittag auf dem Meer
-
- Spiel der Wellen
-
- Die Sirenen (vom vorzüglichen Lorelei Ensemble gesungen)
-
- Dialog von Wind und Meer

Wir waren jedoch nicht gleich bei Debussy, als der zweite Teil anfing: Erst kamen allerlei Tiefseegeräusche und verlockende Sirenentöne. Boston Ballet wollte nämlich nach einer intensiven Zusammenarbeit mit der „Woods Hole Oceanographic Institution“ nicht nur die musikalischen und poetischen Aspekte der Meere vermitteln, sondern auch ihren Zustand und ihre Zukunft. Und die Letztere sieht ziemlich düster aus! Der Komponist Yannis Kyriakides stellte zwischen die Debussy-Sätze eigene Sound-Kulissen als Verbindungelemente, die von verstörenden Tanzszenen begleitet wurden: Ausgerenkte Körperteile überall, gestrandete Fische, die verenden. Ölverschmierte Gestalten, kriechend, nach Luft ringend, die sich in die Fluten werfen, um die Sirenen zu erreichen. Der Sirenengesang, die todbringende Verlockung der alten Griechen, ist in unseren Zeiten der Profit, der die Weltmeere verschmutzt, dem niemand widerstehen kann und wegen dem sich jeder freiwillig ins Verderben stürzt. Während wir in himmlischer Musik schwelgten, erlitten die Fantasiefiguren Qualen und Tod. Drastischer geht’s nicht!

Immersion ist das Modewort der Kulturszene. Das gewählte Thema von allen Seiten anzugehen, multikulturelle Erlebnisse zu bieten, ist fast Pflicht. BB hat es hierbei auf das höchste Niveau gebracht: Nicht nur unglaubliche, akrobatische Leistungen im Tanz, (es wäre unmöglich, alle Namen aufzuzählen!) aber auch atemberaubende, schwindelerregende Videoaufnahmen (Heleen Blanken), Lichtregie (zweimal Brandon Stirling Baker) und Kostüme in allen Meeres- und Hautfarben (Yuima Nakazato) bereicherten die Produktion. Wir tauchten in eine bedrohliche Welt ein, mit allen Sinnen – aber es fiel uns schwer, soviel auf einmal aufzunehmen. Man hätte mehrmals hingehen müssen, um alles zu verstehen und zu verarbeiten. Sowohl mit Verstand als auch mit Emotionen.Das Boston Ballet Orchestra unter der Leitung von Mischa Santora brachte die schwierigen Partituren virtuos und farbenreich zum Gehör. Seine Musikerinnen und Musiker waren in den verschiedenen Musikstilen von Sufjan Stevens, und auch im impressionistischen Zauber von Claude Debussy ausgezeichnet.War es ein mutiger, ein wagemutiger Schritt vom Artistic Director Mikko Nissinen, diese Produktion zu ermöglichen? Er wollte mit Choreographin Nanine Linning den treuen Zuschauern, die klassisches Ballett lieben und unterstützen, nicht nur ausdrucksvollen Tanz, sondern auch den gefährlichen Zustand unserer Meere vor Augen führen. Das Bostoner Publikum ist sonst an Zeitgenössisches Ballett gewöhnt: Choreografien u.a. von William Forsythe, Jorma Elo, Jiří Kylián und John Cranco sind bei ihnen regelmässig im Programm und werden enthusiastisch aufgenommen. Our journey war jedoch mehr – es konfrontierte uns mit der bitteren Wahrheit in einem Kunsttempel, wohin wir eher aus den bitteren Wahrheiten des Lebens flüchten möchten. Ein Wegweiser in die Zukunft, dass wir uns nicht mehr hinter dem Begriff „Kunst“ verstecken können?

Das prächtige 100-jährige Citizens Bank Opera House, wo keine Oper mehr gespielt wird, wo aber das Boston Ballet residieren kann, sucht seinesgleichen in den Staaten. Gebaut 1928, war es eines der zahllosen luxuriösen Vaudeville -Theaters, die damals im italienisch-französischen Stil entstanden. Die meisten wurden abgerissen, denn die Erneuerung erwies sich als zu kostspielig. Boston hat es dank grosszügiger Investoren geschafft, dieses Juwel mit einer umfangreichen Renovation im Jahr 2009 zu retten. Es ist der Stolz der Stadt. Hoffentlich bleibt es weiterhin erhalten – falls unsere Ozeane und mit ihnen auch wir überleben.Die „Woods Hole Oceanographic Institution“ strahlte in ihrer Schlussanalyse immerhin etwas Zuversicht aus. Vorausgesetzt, die Welt bessert sich.
- Aufrufe: 129