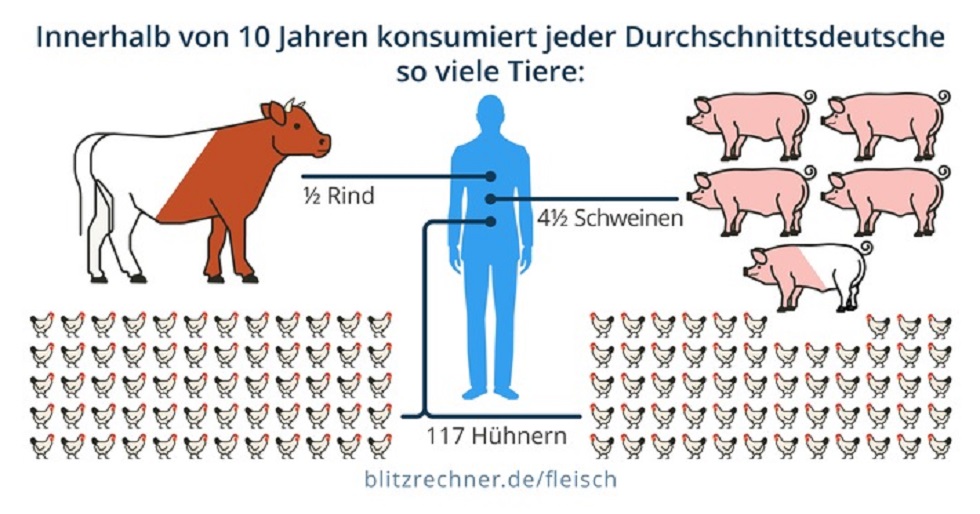Silvesterkonzert des ZKO im KKL Luzern – eine Hommage an das Jahr 2022, von Max Thürig

Besetzung und Programm:
Zürcher Kammerorchester
Willi Zimmermann (Violine und Leitung)
Benjamin Appl (Bariton)
Johann Sebastian Bach Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047
Johann Sebastian Bach Kantate BWV 100 «Was Gott tut, das ist wohlgetan»
Johann Sebastian Bach «Jesus bleibet meine Freude» Choral bearb. für Streicher BWV 147
Johann Sebastian Bach «Bist du bei mir» BWV 508
Johann Sebastian Bach Kantate BWV 170 «Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust»
Johann Sebastian Bach Kantate BWV 194 «Hocherwünschtes Freudenfest»
Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonie Nr. 4 Es-Dur Wq 179 H. 654
Wolfgang Amadeus Mozart I. Allegro, aus: Ein Musikalischer Spass F- Dur KV 522
Wolfgang Amadeus Mozart «Der Vogelfänger bin ich ja» (Papageno Akt I), aus: Die Zauberflöte KV 620
Wolfgang Amadeus Mozart II. Menuetto, aus: Ein Musikalischer Spass F- Dur KV 522
Wolfgang Amadeus Mozart «Papagena!», aus: Die Zauberflöte KV 620
Wolfgang Amadeus Mozart III. Adagio, aus: Ein Musikalischer Spass F- Dur KV 522
Wolfgang Amadeus Mozart «Madamina, il catalogo è questo », aus: Don Giovanni KV 527
Wolfgang Amadeus Mozart IV. Presto, aus: Ein Musikalischer Spass F- Dur KV 522
Wolfgang Amadeus Mozart Aria «Fin ch‘ han dal vino» Nr. 11, aus: Don Giovanni KV 527
Der Silvester markiert den Übergang von einem Jahr zum nächsten! Er motiviert uns Menschen zu einer kurzen Verschnaufpause, muntert uns auf, zurück zu schauen und sich den einen oder anderen Gedanken zum verflossenen Jahr zu machen…
Bach zu Silvester?

So erging es auch mir. Ich freute mich, an diesem letzten Jahrestag dem KKL und dem aufspielenden Zürcher Kammerorchester (ZKO) einen Besuch abzustatten! Das Programm des Silvesterkonzerts mit Benjamin Appl (Bariton) unter der Leitung von Willi Zimmermann hörte sich speziell an; waren doch mit Werken von Bach und Mozart sehr unterschiedliche, um nicht zu sagen gegensätzliche Komponisten zu hören. Aber wie heisst es doch so schön: „Gegensätze ziehen sich an“ oder Gegensätze können bereichern“… So machte ich mich an diesem warmen Vor-Neujahrstag auf nach Luzern, genoss die gelöste und emsige Stimmung im Foyer des KKL, nahm meinen Platz ein und sodann wurde das Publikum von Helene Eller, Geschäftsführung Kaufmännische Leitung des ZKO begrüsst!
Brilliante Solisten
Was für ein fulminanter Auftritt mit dem Brandenburgischen Konzert Nr.2 ! Die Solisten mit Violine, Flöte, Oboe und Trompete brillieren mit ihrem ausgezeichneten Spiel, versetzen mich in einen Glückszustand und liessen in mir positive Gefühle wie ich sie bei einem Start in ein neues Jahr oft verspüre, aufkommen. Voller Optimismus tritt man in ein neues Jahr mit vielen Hoffnungen, Überzeugungen und Vorfreuden ein und geniesst die Einzigartigkeit des Moments!
Musik als Spiegelbild des Weltgeschehens

Im Bewusstsein, dass Freude und Glücksmomente nicht ewig anhalten, spürte ich auch den Stimmungswechsel in der Musik. Die Klänge wurden melancholischer, tiefgründig, komplex, und durch den Auftritt Benjamin Appl’s mit seiner grandiosen Baritonstimme ergreifend und fesselnd. In mir stiegen Bilder auf, die mir einzelne Ereignisse des verflossenen Jahres vor Augen führten, Ereignisse, die über die ganze Welt verteilt waren und uns Menschen in ihren Bann zogen. Stellvertretend seien hier z.B. der Freedom Convoy in Ottawa, der Ukraine-Krieg, der Tod von Masha Amini, der Vulkanausbruch des Hunga Tonga, die Dürre und Hitze in Europa erwähnt. Begleitet von den Arien Bachs mit den teilweise dichten Texten wurde ich in meinen Gedankengängen begleitet und wurde erst mit der lebhaften und stimmigen Sinfonie in Es-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach wieder ins Jetzt zurückgeholt und begab mich aufgemuntert in die Pause.
Dissonanzen peppen auf

Szenenwechsel! Nach der Pause versprach das Programm mehr Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Aus Mozarts Zauberflöte wartete z.B «Der Vogelfänger bin ich ja», oder «Papagena! Papagena!» und aus Don Giovanni «Madamina, il catalogo è questo» Wohltuend, diese Musik! Hervorragend interpretiert und theatralisch vorgetragen vom Benjamin Appl! In den Hintergrund gerückt war die eher ernste Musik Bachs. Farbige, lustige und berührende Momente blitzten im Kopf auf, zeigten ein Bild der Menschheit im Kontrast zu Angst und Schrecken, zeigten Menschen, die sich im friedlichen Wettkampf wie an den olympischen Winterspielen in Peking oder an der Fussball WM in Katar massen. Der Mensch wurde in seinen verschiedenen Facetten gezeigt. Speziell angetan hat mir dabei das «II Menuetto maestoso» ein musikalischer Spass von Amadeus Mozart. Herrlich, diese eingebauten Dissonanzen, die trotz oder gerade wegen ihrer Schrägheit die Szene positiv belebte und uns Menschen aufzeigte, dass «Fehler» auch bereichernd und beglückend sein können; vorausgesetzt: sie sind nicht verletzend!
2023 – ich freue mich

Zufrieden und mit einer guten Stimmung freute ich mich nach der Arie «Fin ch’han dal Vino» aus Don Giovanni meinen Exkurs zum Jahr 2022 zu beenden und im kleinen Kreis auf das kommende Jahr anzustossen. In der Hoffnung, dass in der Summe aller Ereignisse das Positive im Zusammenspiel mit allfälligen schwierigen Herausforderungen überwiegen wird, verliess ich das KKlL nach dieser sehr gekonnten Darbietung des Zürcher Kammerorchesters beschwingten Schrittes!
Text: www.maxthuerig.ch
Fotos: Rolf Winz und www.zko.ch
Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch
www.herberthuber.ch www.leonardwuest.ch
- Aufrufe: 159