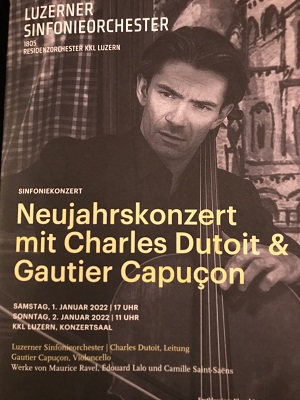Luzerner Theater, Macbeth von Giuseppe Verdi, Première, 22.1.22, besucht von Léonard Wüst

Produktionsteam und Besetzung:
Musikalische Leitung: Hossein Pishkar Regie: Wolfgang Nägele Bühne und Kostüme: Valentin Köhler Licht: David Hedinger-Wohnlich Musikalische Assistenz und Nachdirigat: Jesse Wong Dramaturgie: Johanna Mangold , Christine Cyris Choreinstudierung: Mark Daver
Hrólfur Sæmundsson (Macbeth) Christian Tschelebiew (Banco) Susanne Elmark (Lady Macbeth) Eyrún Unnarsdóttir (Dame der Lady Macbeth) Diego Silva (Macduff) Robert Maszl (Malcolm) Sebastià Peris (Arzt / Diener / Mörder / Herold) Luzerner Kantorei (Erscheinungen) Statisterie des Luzerner Theaters (Erscheinungen) Chor- und Extrachor des Luzerner Theaters Luzerner Sinfonieorchester
Uraufgeführt wurde die Oper am 14. März 1847 im Teatro della Pergola in Florenz,
eine revidierte Fassung wurde am 21. April 1865 im Théâtre-Lyrique in Paris uraufgeführt. Die Luzerner haben sich entschieden, eine Mischung der beiden grundsätzlichen Versionen zu Inszenieren. Dafür konnte die international gefeierte dänische Sopranistin Susanne Elmark gewonnen werden und als Macbeth der isländische Bariton Hrólfur Sæmundsson.
Ab Homepage des Luzerner Theater
Ist Macht ein Fluch oder Segen? Und ist Liebe zwischen zwei Menschen immer ein positives Gefühl?

1847 schafft der 34-Jahre junge Giuseppe Verdi auf der Basis von William Shakespeares gleichnamigem Drama mit «Macbeth» ein musikdramatisches Werk, das eine skrupellose Welt vor Augen führt. Macbeth, dem von drei Hexen der Königstitel verheissen wurde, ermordet gemeinsam mit der Lady unter seinem eigenen Dach den König, um dessen Krone und Macht an sich zu reissen. Es ist eine Welt geprägt von Macht, Terror und Mord, in der zwei Menschen, um der Herrschaft willen herrschen wollen. Hier entscheiden Willkür und Zufall über Aufstieg und Fall von Königreichen, die Skrupellosen erzwingen die Gunst der Stunde mit Gewalt.
In der Rezeptionsgeschichte der Oper wird immer wieder betont, Verdi habe im «Macbeth» auf eine Liebesgeschichte verzichtet. Für Regisseur Wolfang Nägele sind Macbeth und die Lady durch eine mächtige Liebe miteinander verbunden, die zum Katalysator der destruktiven Kräfte wird. Realitätsverlust, Wahnvorstellungen und eine symbiotische Verschmelzung sind die Folgen, die musikalisch vor allem in der zweiten Fassung von 1865 übersetzt sind. Verdis Oper spricht mit voller Wucht zu uns und erzählt von der manischen Liebe eines Paares, das die gesamte politische Welt und die Menschen um sich herum mit in den Abgrund reisst.
Aufschrei von Feministinnen zu befürchten?

Entgegen dem Weiblichkeitstrend, manchmal Wahn gar «Gschtürm» präsentiert das LT eine Oper, die fast ohne weibliche Stimmen auskommt, klammert man die überragende dänische Sopranistin und die Chorstimmen mal aus. Die Hexen betrachte ich hier geschlechtsneutral als Sache, also das Hexe, plural die Hexen, da ich den Shitstorm nicht erleben möchte, wenn ich die dem weiblichen Geschlecht zuordnen würde. Obwohl sie ja in sämtlichen Märchen, siehe z.B. «Hänsel und Gretel», gendergerecht «Gretel und Hänsel», weiblichen Geschlechts sind.
Grundsätzliches zu Verdis Macbeth
Verdi wollte mit Macbeth die Tradition des «Bel canto» hinter sich lassen, wurde dafür von der Kritik als «Totengräber des italienischen bel canto» und Stimmenvernichter bezeichnet, das konnte aber den grossen Zuspruch des Publikums nicht bremsen. Verdi überarbeitete aber die erste Version, fügte mehr Chorsequenzen hinzu.

Die auf Shakespeare zurückgehende Schauergeschichte um das machthungrige Ehepaar Macbeth, das, durch Weissagungen ermutigt, den schottischen König und weitere Adlige umbringt, um selbst den Thron zu besteigen, interpretiert Hossein Pishkar mit einer an Alfred Hitchcock erinnernden Berechnung. Leichtigkeit und sogar Witz bilden hier die Grundlage für grauenerregende Akzente seines analytischen Dirigats.
Hrólfur Sæmundsson in der Titelrolle ist mit jeder Faser seines Körpers Macbeth: in den kantablen Momenten und in den dramatischen. Er ist ohne Zweifel ein überragender Bariton, sowohl die Stimmkultur betreffend als auch die Intelligenz seiner Interpretation. Seine Arie “Pietà, rispetto, amore” gehört zu den Stücken, die man sich wieder und wieder anhören möchte – er gibt dieser Musik, die oft zu Reißern verkommen ist, Bedeutung und Noblesse. Susanne Elmark beherrscht die Rolle der Lady Macbeth. Sie hat Sinn für der Lady`s dämonische Seite, besonders ihre Anrufung der Hölle im ersten Akt betreffend (“Or tutti sorgete”). Sie überzeugt gequält in der großen Nachtwandelszene. Großartig ebenso ihr “Trinklied” am Ende des zweiten Aktes. Das Premierenpublikum geizte nicht mit jeweiligem Szenenapplaus.
Postmoderne Klagemauer an der Plaza de Mayo

Neben einigen substantiellen, gar etwas vulgären Einfällen zu Beginn, etwa der teilweise entblössten Darstellung des Königs und anderen Edelleuten ( mit Windeln bekleidet, an Rollator schreitend etc.) oder der zweiten “Erscheinung” in der Hexennacht, ist die Inszenierung von Wolfgang Nägele mit treffenden Symbolen «garniert»: Der sich teilweise aufrichtende Boden wird von den Schott*innen später als Pinwand genutzt, um die Fotos von Ermordeten und Verschollenen anzupinnen, eine postmoderne Klagemauer, vor der die schottischen Bürger*innen ihre Verluste, die Ermordung ihrer Führer beklagen, eine Szene, erinnernd an die argentinischen Mütter, die «Madres de Plaza de Mayo», die sich auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude versammelten, um an den Verlust ihrer Männer und Kinder unter der Militärdiktatur zu erinnern und protestieren. Bedrückend die düstere Gesamtwirkung der Bühne, wo sich trauernde, verloren wirkende Gestalten bewegten.
Der Baritonvulkan von der Feuerinsel und seine ebenfalls skandinavische Sopranistinnen Bühnenkollegin sangen und spielten überragend

Der isländische Gastbariton Hrólfur Sæmundsson singt kräftig und dann fast lyrisch schwermütig. Susanne Elmark meistert mühelos und schnell den Wechsel von gurrenden Tiefen zu höchsten Tonlagen. Verdi ging es in dieser noch frühen Oper bereits schon weniger um Schöngesang, sondern um abgründige, oft expressive Effekte. Auch Diego Silva als Macduff überzeugte. Für Sängerinnen ist die Lady Macbeth eine besondere Rolle. Sie ist die einzige wirklich präsente Frauenrolle in diesem Werk. Und sie ist – seltenst für das 19. Jahrhundert – diejenige, die die Fäden zieht. Mal abgesehen von den Hexen als Schicksalsbild – gesungen von einem vielstimmig durchscheinend und verführerisch reinen Chor zum hervorragend plastisch musizierenden Luzerner Orchester unter Hossein Pishkar.

Aber zurück zu Elmark. Sie bestimmt die ersten beiden Akte. Vom grausamen Kalkül zum Machtrausch, den sie ins Psychotische kippen lässt. Ihre Stimme ist wahnsinnig vielsagend. Sie verfügt über ein beinahe gurrendes Vibrato in den Höhen, wenn sie bezirzt, ohne je schrill oder hart zu werden. Sie lässt die Koloraturen überschnappen wie ein Wahnsinn, der sich ankündigt. Sie sirrt und summt die Chorlinien mit, während des Festes im zweiten Akt und ist da psychisch eigentlich schon am Ende. Hrólfur Sæmundsson als Macbeth geht dazu den umgekehrten Weg. Die ersten beiden Akte ist er fahl im Gesicht und gesanglich noch etwas zurückhaltend. Lässt der Kraft der Frau allen Raum, den sie braucht, um derart zu beeindrucken. Später dann, im Duett mit einem in Höchstform agierenden Diego Silva als Macduff, gibt er dem Macbeth mehr Profil. Aber so lange die Frau an seiner Seite ist, ist sie das Zentrum, politisch und strategisch.
Aussergewöhnlich beeindruckende Stimmen

Von den Stimmen an diesem außergewöhnlichen Premierenabend kann man nicht genug bekommen: Christian Tschelebiew muss als Banco mit edlem Bass viel zu früh sterben, und Robert Maszl kommt erst am Schluss als rächender Malcolm richtig zum Zug, wenn das ganze Imperium Macbeths in mächtigen Gefühlsausbrüchen untergeht. Zuvor hat sich Susanne Elmarks Lady in der Schlafwandel-Szene eher innig und verletzlich gezeigt und verschwindet fast nebenbei. Der Kommentar von Macbeth, “Was bedeutet schon ein Leben?” bekommt auf diese Weise großes Gewicht, genauso wie sein Schluss-Fluch auf “la vile Corona” – die “niederträchtige Krone” – besonders überzeugend wirkt. Hrólfur Sæmundsson singt auf diesem sehr hohen Niveau, begleitet vom Luzerner Sinfonieorchester in nicht enden wollender Perfektion. Die großen Chorszenen – von den Hexen bis zum gegen den Unterdrücker aufbegehrenden Volk – sind exzellent gearbeitet und schaffen Gänsehautmomente mit feinsten Nuancen und mächtigen Fortissimi. Das, mit Ausnahme eines hängenden Lichtervorhanges, gänzlich schwarz-düstere Bühnenbild ist perfekt auf die Musik abgestimmt.
Perfektion bis zum bitteren Ende

Auch im dritten Akt gelingt erneut ein optimales Zusammenspiel von Szene und Musik, wenn sowohl Macbeth, als auch der bereits gestorbene Banco und zuletzt die ekstatisch wirkende Lady Einblicke in ihr Seelenleben gewähren. Da entfaltet Verdis Musik eine faszinierende Kraft, auch ganz ohne Gesang. Besonders berührend auch alle Szenen mit den Kinderdarstellern, die auch gesanglich glänzten.

Zu Macbeth allgemein passt ein Zitat von Hannah Arendt:
«Macht aber besitzt eigentlich niemand, sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen.»
Fazit: Eine herausragende, trotz der sehr düsteren Shakespearegeschichte, strahlende Galavorstellung der Protagonisten, die das Premierenpublikum restlos begeisterte, und die von ebendiesem mit einer langanhaltenden «Stehenden Ovation» belohnt wurde.

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.luzernertheater.ch Ingo Hoehn
Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch
- Aufrufe: 98