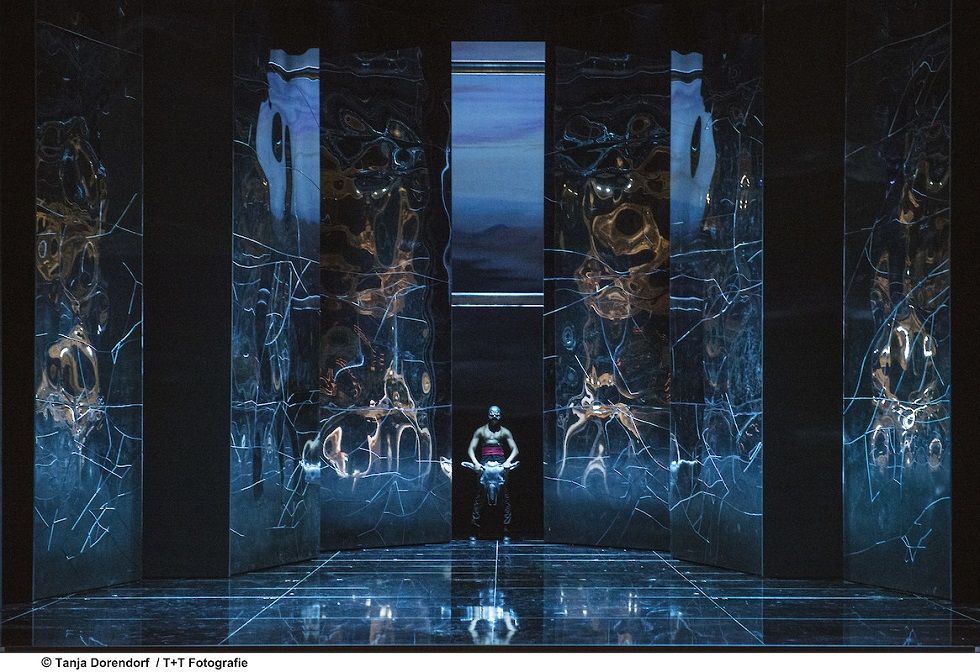Besetzung und Programm:
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam
Tugan Sokhiev Dirigent
Tabea Zimmermann Viola
Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56a
Konzert für Viola und Orchester Sz 120
Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13 Winterträume
Rezension:
Johannes Brahms Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56a
Man meint reine Kirchenmusik zu hören wenn man sich auf das einleitende Thema
fokussiert, so erhaben, ja glorios lässt es sich an mit den charakteristischen Einwürfen von Horn da wieder Fagotte, die indes immer wieder von den Streichern abgefedert werden. Die Melodie schreitet, wie bei einer Prozession, im Zweivierteltakt selbstsicher voran. Aus der Bläserbesetzung wird ein Sinfonieorchester. Und aus dem kraftvollen Chorale St. Antoni? Johannes Brahms gibt der Melodie in acht Variationen verschiedene Farben, wechselt von Dur nach Moll, verleiht ihr einen tänzerisch, fast wilden Charakter, lässt sie geisterhaft wie im Nebel klingen und mündet im Finale in einer Passacaglia.
Choral geht nie verloren
Bei all diesen Wandlungen geht der ursprüngliche Choral nie ganz verloren. Die meisten Experten sind ja heute der Meinung, dass das Werk mitnichten auf einem Thema, des, nicht nur von Brahms verehrten Haydn aufbaut. Als Johannes Brahms 1870 im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien stöbert, entdeckt er den Chorale St. Antoni. Ein kleines Stück Musik aus dem Divertimento B-Dur des Komponisten Joseph Haydn; so glaubt zumindest Johannes Brahms über sein Fundstück.
Wahrscheinlich doch nicht Haydn der geistige Vater
Heute sind sich die meisten renommierten Musikwissenschaftler ziemlich sicher, dass dieser kleine Bläserchoral eher einem Schüler Haydns, nämlich Karl Ferdinand Pohl, zuzuschreiben ist. Anyway, Dirigent Tugan Sokhiev führt sein Orchester souverän feinfühlig durch das Werk, lässt den Solisten Gehör, indem er das Basisvolumen des Klangkörpers jeweils zurücknimmt, dezenter hält, wenn diese zum Zuge kommen. Ein äusserst gelungener Auftakt in diesen Konzertabend, vom sachkundigen Publikum im gutbesetzten Saal, mit viel Beifall honoriert.
Béla Bartók Konzert für Viola und Orchester Sz 120
Von Bartok kennt man ja eher die sehr bekannten Violinkonzerte die im Repertoire der allerwenigsten Geigensolisten fehlen. Weit weniger bekannt und gespielt hingegen ist ein Auftragswerk für den schottischen Bratscher William Primrose, der ihm auf den Weg gab, ein Konzert zu schreiben und dabei keine technischen Limits des Instrumentes zu berücksichtigen. Der Solopart dominiert in faszinierender Weise. Das Konzert ist eine Bereicherung im nicht gerade großen Bratschenrepertoire. Trotz seiner Leukämieerkrankung komponierte der Ungar unverdrossen fort, fast bis zum letzten Atemzug. Sein Bratschenkonzert konnte er dennoch nicht mehr vollenden – es wurde nach seinem Tod von dritter Hand ergänzt, erweitert, in der Substanz verändert.
Tabea Zimmermann fand ihren ureigenen Bartok

Tabea Zimmermann aber hat sich die autographen Skizzen vorgenommen und Bartóks originale Intentionen ergründet und so den eigentlich «letzten Willen» des Komponisten präsentiert. Die Solistin stieg, dank ihres passionierten Vorspiels, unmittelbar in Bela Bartóks Klangwelten ein, der Ton war schon preludierend so geschmeidig wie reichhaltig und sie vermochte es, mit meist geschlossenen Augen zu spielen, Orchester und Publikum in ihre Interpretation zu ziehen. Tabea Zimmermann sorgte für die perfekte Synchronie und das Gleichgewicht aller Beteiligten und dafür, dass sie, als Solistin, das akustische Podium erhielt, von dem aus sie strahlen konnte. Und wie sie strahlte, damit das Auditorium und auch ihre Mitmusiker in ihren Bann zog.
Tänzerisch durch die Partitur
Sie tanzte im ersten Satz förmlich von einem Bein zum anderen, getrieben durch die Energie, die von ihrem Bogenstrich ausging. Die triumphierenden Blechbläser signalisierten das Ende des Moderatos, dessen finale Chromatik eine späte Brücke zu Debussys Prélude schlug. Im Adagio religioso spielte die Bratsche auf einem delikaten Hauch von Nichts der Streicher und seine Zartheit gab dem zweiten Satz tatsächlich eine besondere Spiritualität. Im Allegro vivace bewegte sich dann der Dirigent zu Zimmermanns orientalisierender Bratsche und den rhythmischen Beschwörungen von Tuba und Pauke.
Ein Bartok wie von Mozart
Zimmermann spielte das Konzert mit einer liebevollen Sanglichkeit, als wäre es von Mozart, und zeigt den Melodiker Bartók, aber auch einige wunderbare Momente der Stille. Dabei kann Zimmermann durchaus auch mal energisch sein, ihren Part mit vollem Körpereinsatz durchziehen, das Ortchester mitnehmen auf die Reise. Das Publikum war hingerissen und überschüttete die Solistin mit einer nicht enden wollenden Applauskaskade, die natürlich die Mitmusiker mit einschloss.
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13 Winterträume
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. So lässt sich Tschaikowskys Stimmung beschreiben, als ihm sein Lehrer Anton Rubinstein den Auftrag gibt, seine erste Sinfonie zu schreibender 24-Jährige macht sich mit hellem Eifer an sein Opus 13, bricht aber bald zusammen. «Ich bin nutzlos, ich bin eine Null», sagt er sich in selbstzerstörerischer Weise. Trotz solcher schweren Zweifel vervollständigt er die Sinfonie. Sie heisst «Winterträume» und ist voller Stimmungsbilder. Dieser Romantisch-tragische, Herzzerreißende Geist, der durch diese Symphonie streicht ist umwerfend. Und dann dieser zweite Satz. Ein sanftes Thema der gedämpften Streicher umrahmt den Satz.
Schwelgen in Sehnsucht
Das eigentliche Hauptthema ist eine sehnsuchtsvolle Oboen Melodie, die ständig zwischen Dur und Moll schwankt. Mit dieser Melodie motivisch verwandt ist auch das dritte Thema des Satzes, welches in den Bratschen erklingt. Höhepunkt des Adagios ist die letzte Wiederkehr des B-Themas in den Hörnern, ehe die Wiederaufnahme des Streicherthemas den Satz ruhig ausklingen lässt. Von Ihm geht mit seinen sehnsüchtigen, wehmütigen Themen, eine ganz besondere, heilende Kraft aus. Schöner kann man wohl kaum einen „langsamen“ Satz komponieren, so über alles erhaben.
Wenn Winterträume zum Sommertraum mutieren

Dieser Satz könnte auch gut „Sommerträume“ heißen. Die zweiten Geigen klingen wie Grillen, hinter den Hauptthemen. Dirigent Tugan Sokhiev, vorher schon aufgefallen durch ausgeprägte, aber trotzdem dezente Gestik, viel Mimik und Augenkontakte, liess das Orchester zur Hochform auflaufen. Auch er ein Schüler von Ilja Musin, wie auch u.a. folgende zu Weltruhm gelangten Dirigenten: Yuri Temirkanov, Valery Gergiev, Odysseas Dimitriadis, Semyon Bychkov, Teodor Currentzis. So war denn auch sein Gebaren nicht unähnlich dem, von mir sehr verehrten Teodor Courrentzis. Dieses Ausstrahlen einer seltsamen Mystik im Dirigat erfasste auch seine Mitmusiker und dieses Gesamte, entführte uns in eine aussergewöhnliche Wunderwelt des Wohlklangs.
Spektakuläres Finale
Der letzte Satz beginnt mit einer düsteren Moll-Einleitung. Bald wird jedoch das Tempo beschleunigt, und es erklingt das fröhlich-markante G-Dur-Hauptthema im vollen Orchester. Als Seitenthema verwendet Tschaikowski die Melodie aus der Einleitung. Insgesamt zeigt dieser Satz bereits die Vorliebe des Komponisten für effektvoll dahinstürmende, bisweilen lärmende Finali. Solch Pompöses liebt ja auch das Publikum und feierte die Musiker denn auch entsprechend mit wahren Beifallsstürmen. Als Zugabe gewährte man noch etwas Prokofjew, sehr zur Freude des Auditoriums, das sich aber nicht zu einer stehenden Ovation entschliessen konnte.
Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.lucernefestival.ch
Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch
www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch Paul Ott:www.literatur.li