MusikWerk Luzern, DIE SCHWEIZER IN PARIS von Anna Rybinski

Nein, es geht nicht um den helvetischen Tourismus; auch nicht um die Eidgenossen, die in manchen Schlachten für den König von Frankreich ihr Leben opferten. MusikWerk Luzern will in der neuen Saison die Generation der Schweizer Komponisten bekannter machen, die nach 1900 in Paris studierten und frischen Wind in das konservative hiesige Musikleben brachten.
Was ist MusikWerk Luzern?
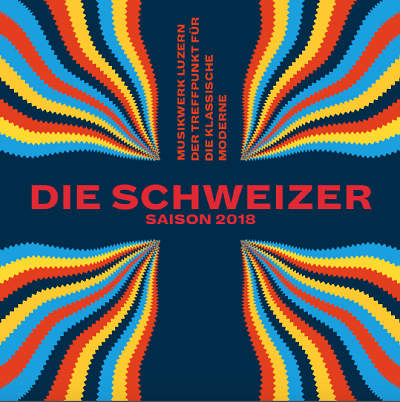
MusikWerk Luzern versteht sich als Werkstatt und Treffpunkt für die Klassische Moderne und präsentiert Werke der hervorragenden Komponisten des 20. Jahrhunderts. Die künstlerischen Leiter Beni Santora und Adrian Meyer stellen jedes Jahr eine bedeutende Persönlichkeit in den Mittelpunkt, die in ihrem gesamten Wirkungskreis porträtiert wird. Auch die Zusammenhänge der Musikwerke mit Literatur und bildender Kunst werden aufgezeigt.
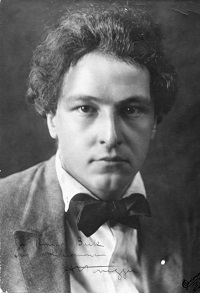
Im Jahr 2015 stand Arnold Schönberg im Mittelpunkt, 2016 Bohuslav Martinů und 2017 Igor Stravinsky.
Herausragende, international tätige Musiker gestalten die Konzerte, die sich im Ensemble Metropolis – dem exklusiven Ensemble der Konzertreihe – zusammengefunden haben.
Das Jahr der Schweizer

2018 wird nicht eine Persönlichkeit, eher eine Generation von Komponisten in Fokus gestellt: Arthur Honegger, Frank Martin und Conrad Beck sind diejenigen, die in den fünf Konzerten der Saison 2018 mit ihren Freunden und Zeitgenossen präsentiert werden, unter anderen mit Vincent d‘Indy, Darius Milhaud und Francis Poulenc. Der Zusammenschluss einiger Musiker in Paris unter dem Namen «Groupe des Six» und «École de Paris» bedeutete damals lose Gruppierungen, welche als Avantgarde der Musikszene Berühmtheit erlangten.
Auch zwei Innerschweizer, Joseph Lauber und Othmar Schoeck, sind in den Konzerten mit charakteristischen Werken vertreten. Obwohl keine Repräsentanten der neuen Stilrichtungen, spielten sie doch eine wichtige Rolle im Schweizer Musikleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Der erste Konzertabend ist eine Hommage an Joseph Lauber, der vielleicht als Erster aus dem Schatten der übermächtigen deutschen Nachbarn heraustreten wollte und in Frankreich studierte.
Die Konzertdaten von MusikWerk Luzern:
«Direktverbindung Ruswil-Paris» 24. Februar
«2×6 in Paris» 14. April
«Radio Basel» 9. Juni
«Herbstgesang» 20. Oktober
«Mimaamaquim» 15. Dezember
Die Konzerte finden jeweils um 19.30 im neugestalteten Zentrum MaiHof statt – der Raum bietet ideale akustische Voraussetzungen für das Repertoire von MusikWerk Luzern. Die Kombination aus Stein und Holz, die differenzierte Beleuchtung und die aufgelockerte Sitzordnung verleihen den Abenden eine besondere Intimität. Nach dem Konzert lädt die Bar Gäste und Musiker jeweils zum Austausch ein.
Über eine Radiostation

Es gab Zeiten, als über den Service Public noch nicht diskutiert wurde, als keine No-Billag-Initiative existierte und der öffentlichen Rundfunkanstalt im kulturellen Leben des Landes eine wichtige Rolle zukam. Das waren die Zeiten ohne Fernsehen, ohne Gratiszeitungen und mit viel weniger Konzertangeboten in Stadt und Land. Das Radio Basel erfüllte die Sehnsucht nach Informationen, Literatur, Cabaret und Theater – und auch nach klassischer Musik. Es hatte nämlich ein eigenes Rundfunkorchester und die Konzerte wurden live ausgestrahlt. Dank Studiokonzerten mit Musik von Zeitgenossen und Uraufführungen mit Auftragswerken erfüllte das Radio auch den Wunsch nach Neuem.
Damals wurde eine junge Garde von Komponisten entdeckt, gefördert, finanziell über Wasser gehalten und dank der Radiosendungen in ganz Europa bekannt gemacht. Das Radio war eine kulturelle Grossmacht. Der Herr über dieses Medium war 30 Jahre lang Conrad Beck: in Schaffhausen geboren, in Zürich aufgewachsen und als Komponist in Zürich und Paris ausgebildet.
An fünf Abenden von MusikWerk Luzern erleben Sie Programme, wie sie der Rundfunksender «Radio Basel» (ein Vorgänger des heutigen SRF) damals hätte ausstrahlen können.
Text: annarybinski.ch/
Paul Ott:www.literatur.li
- Aufrufe: 434
























