Analog ist das neue Bio: Digital-Diäten und Facebook-Fasten

- Aufrufe: 487


Über 70 Künstler performen in einer grandiosen Inszenierung das geniale Pink Floyd Konzeptalbum, 33 Jahre nach der Veröffentlichung des Films von Alan Parker und dem erfolgreichsten Album “ANOTHER BRICK IN THE WALL“ mit den akuten Ängsten der Einsamkeit, Verluste, Kriege, Entfremdung in der Ära der Krise und Globalisierung live.
“The Wall” das bekannte Pink Floyd Konzeptalbum, ist heute, 36 Jahre nach der Veröffentlichung mit einer neuen Produktion wieder auf der Bühne.
Eine beeindruckende Live Orchestrierung mit mehr als 70 Künstlern auf der Bühne, wertet die Mischung aus Rock und klassischer Musik auf und versetzt das Publikum zurück in die ursprüngliche Version von “The Wall”. Live-Videos werden auf eine Grossleinwand projiziert, diese erzeugen zusammen mit einer spektakulären Licht-Show räumliche Tiefe und Emotionen.
Das Konzeptalbum «The Wall» von Pink Floyd wurde 1979 veröffentlicht und wurde zu einem Riesenerfolg. Über 30 Millionen wurden verkauft. Die Rockoper erzählt die Geschichte eines jungen Rockstars, der beginnt, eine imaginäre Mauer um sich zu errichten, um sich vor äusseren und emotionalen Einflüssen zu schützen. Damit isoliert er sich auch von sozialen Kontakten. Erst als die Mauer eingerissen wird, kommt der verletzliche Musiker wieder frei.
Kommentierung des Events durch Léonard Wüst
Unbegreiflich, dass noch nicht allen Veranstaltern bekannt ist, dass die Stadthalle Sursee nicht gerade für ihre optimalen akustischen Voraussetzungen berühmt ist.
Spätestens bei der Feststellung, dass nur ca. 2/3 der vorhandenen Plätze besetzt sind, muss doch der Tontechniker den Halleffekt der Gesangsanlage dementsprechend mindern. Also schon mal nicht der Boden, worauf Gutes bis sehr Gutes gedeihen kann. Erschreckend schwach auch die Projektionen an die Leinwand, völlig asynchron. Dringend geraten, wenn man das nicht perfekt im Griff hat, lieber auf diese optischen Spielereien verzichten und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Kam hinzu, dass auch Teile der Musik aus Backgrounhdbasis unterlegt waren, sowas muss zwangsläufig im Desaster enden, ausser das Publikum ist so nichtsahnend oder gleichgültig desinteressiert wie es offensichtlich an diesem Abend der Fall war. Dabei wären das Orchester und die Sänger/innen durchaus passabel gewesen, aber die Backgroundsängertruppe stand irgendwie verloren desinteressiert hinter dem Orchester, wirkte wie eine dorthin dirigierte Laientheatergruppe, fast völlig bewegungs- und emotionslos. Da kam einfach zu wenig rüber und the wall, also die Mauer zwischen Akteuren und Konsumenten fiel nie, ja bröckelte kaum mal, einzig bei „another brick in the wall“ kam etwas Stimmung auf. Aber leider verpassten die Protagonisten den Schwung mitzunehmen und alles verflachte wieder und dümpelte so dahin, abgesehen von ein paar Soli der beiden sehr guten Leadgitarristen und einigen schlagkräftigen Kontrapunkten der Perkussionisten.
Da habe ich mir inständig gewünscht, dass die einfach den Scorpions Megahit Wind of Change mit in die Show eingebaut hätten (gehört zwar nicht unmittelbar zur Geschichte), verbunden mittelbar aber mit dem tatsächlichen Mauerfall am 9. November 1989 in Berlin. Das hätte wohl niemanden gestört, aber diesen Abend noch retten können.
Fazit: Nicht immer funktioniert die Formel man nehme ein Stück Rockgeschichte, motze es mit ein paar Videoprojektionen u.ä. auf. Wenn die Qualität entsprechend hoch ist, geht’s. Dem war aber leider nicht im Geringsten so. Es tummeln sich offensichtlich zu viele Veranstalter auf diesem umkämpften, in der Schweiz dank den sehr hohen Eintrittspreisen, lukrativen Markt, wie selbst Insider betonen und darunter leidet halt die Qualität zwangsläufig.
Der dann doch noch respektable Schlussapplaus erinnerte mich stark an frühere Zeiten, als man bei Charterflügen nach geglückter Landung noch geklatscht hat. weils einfach so üblich war und dazu gehörte. Ergo: gesehen, gehört und abgehakt.
Trailors von Pink Floyd Songs:
THE WALL LIVE ORCHESTRA hochgeladen von DANIELE IACOPETTI
www.youtube.com/watch?v=yAUeIZxXxBY
The Icarus Line - Up Against The Wall
www.youtube.com/watch?v=MeBm5ImMAZw
Pink Floyd - Another Brick In The Wall (HQ)
www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
Text: www.leonardwuest.ch
Homepages der andern Kolumnisten: www.marvinmueller.ch www.gabrielabucher.ch
www.irenehubschmid.ch Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li
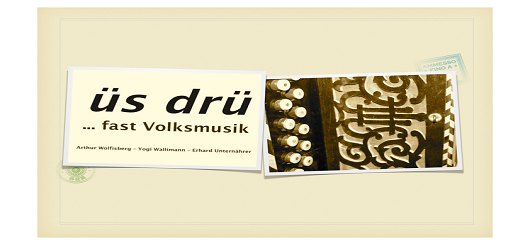 Das alte Sprichwort bewahrheitete sich einmal mehr. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Das alte Sprichwort bewahrheitete sich einmal mehr. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Mein Entscheid, das Konzert von Keith Jarrett im Luzerner KKL, wo ich akkreditiert war, nicht zu besuchen und stattdessen wieder mal einheimisches Schaffen neugierig zu betrachten und anzuhören, hat sich mehr als gelohnt. Im schmucken, prallgefüllt/ausverkauften Sorser Kleintheater „Somehuus“ boten Üs drü uns ca. nünzg ein vielfältiges spannendes Konzert, voll Witz, Charme, Engagement, vielschichtigen, teils hintergründigen, manchmal doppelsinnigen Eigenkompositionen. Texte die aufmunterten, auch solche die zum Nachdenken anregten ohne missionarisch daher zu kommen, Die Kompositionen sehr eigenständig, solide, gut arrangiert, motoviert und mit sehr solider instrumentaler Technik zelebriert, mit sichtbarer Freude interpretiert, sprang der Funke auch unmittelbar auf die faszinierten Zuhörer über.
Auch die von der der Protagonisten zwischen den einzelnen Stücken charmant inspirierend vorgetragenen Erläuterungen zum Werdegang und den Aktivitäten, das Drum und Dran der Band trugen das ihre zum Gesamtkunstwerk bei.
 Konzertablauf im Detail: Gestartet wurde, logischerweise, mit „ganz am Aafang“, worauf mit „Koriander“ schon die erste Würze folgte, mit „Iidrück“ wurden uns ebendiese anhörlich und iidrücklich vermittelt, worauf Erhard, der Bassist, gestenreich den „Ballonschottisch“ als nächstes Stück forderte, den ihm seine Mitmusiker auch gnädig gewährten. Zeitgemäss beanspruchte Yogi dann ein „Flat Basic“ für sich, danach man alles mit emene „Halbe Wisse“ begoss. Mit zarten, selbstgespielten Violinen Klängen durchschritt die extra aus Barcelona angereiste Simone Lambregts den schmalen Gang des Raumes und gesellte sich zu den dreien auf der Bühne, die somit jetzt zu viert waren. Lambregts Komposition „els Vals de Sant Marti“ eröffnete dieses Zwischenset, wo sich Catalunya und Urschweiz musikalisch harmonisch vereinten. Beim anschliessenden Kerbel mischten sich leichte irische Einflüsse in Wallimanns Komposition, schadet ja nicht, dem Kerbel ein bisschen Inselgrün beizumischen. Für den Abschluss des Sets, gleichzeitig letztes Stück vor der Pause, wählten die Musiker das leicht kritische Stück „de Priis defür“. unseren manchmal bedenklichen Umgang mit der Natur leise hinterfragend. Ein grosser langer Applaus begleitete die vier in die wohlverdiente Pause, die von den Konzertbesuchern für angeregte Diskussionen und Statements genutzt wurde.
Konzertablauf im Detail: Gestartet wurde, logischerweise, mit „ganz am Aafang“, worauf mit „Koriander“ schon die erste Würze folgte, mit „Iidrück“ wurden uns ebendiese anhörlich und iidrücklich vermittelt, worauf Erhard, der Bassist, gestenreich den „Ballonschottisch“ als nächstes Stück forderte, den ihm seine Mitmusiker auch gnädig gewährten. Zeitgemäss beanspruchte Yogi dann ein „Flat Basic“ für sich, danach man alles mit emene „Halbe Wisse“ begoss. Mit zarten, selbstgespielten Violinen Klängen durchschritt die extra aus Barcelona angereiste Simone Lambregts den schmalen Gang des Raumes und gesellte sich zu den dreien auf der Bühne, die somit jetzt zu viert waren. Lambregts Komposition „els Vals de Sant Marti“ eröffnete dieses Zwischenset, wo sich Catalunya und Urschweiz musikalisch harmonisch vereinten. Beim anschliessenden Kerbel mischten sich leichte irische Einflüsse in Wallimanns Komposition, schadet ja nicht, dem Kerbel ein bisschen Inselgrün beizumischen. Für den Abschluss des Sets, gleichzeitig letztes Stück vor der Pause, wählten die Musiker das leicht kritische Stück „de Priis defür“. unseren manchmal bedenklichen Umgang mit der Natur leise hinterfragend. Ein grosser langer Applaus begleitete die vier in die wohlverdiente Pause, die von den Konzertbesuchern für angeregte Diskussionen und Statements genutzt wurde.
Im zweiten Konzertteil gings über die „Braut“, „Sponti-bayerisch Russ„ weiter mit "40i", dem Erhard gewidmeten „Fis c H“ (Notensetzung für Erhards Bass an dem er auch entsprechend heftig herumturnte, dann iäred die Musiker gemeinsam, von gratul iäred über integr iäred, interpret iäred zu kritis iäred usw. Als sie damit fertig waren gesellte sich Simone mit ihrer Geige wieder dazu und man erlebte einen „Sommer im Herbst“, dann den absoluten Höhepunkt in Form gekonnter Soli bei „Gasparin“, abgewedelt durch die „Palme“. So einfach liess man die formidable Formation aber nicht gehen, heftigst auf die Bühne zurückapplaudiert, gabs noch „1/4 Stund“ als Zugabe, die aber doch nicht ganz so lange dauerte. Fazit: ein beeindruckendes intensives Erlebnis, das nicht nur die musikalischen Sinne ansprach, sondern auch durch die dargereichten Anekdoten, ebenso mit viel Wortwitz und Selbstironie zu überzeugen, gar zu begeistern wusste.
Text: www.leonardwuest.ch
 Fotos: Üs drü und www.somehuus.ch
Fotos: Üs drü und www.somehuus.ch
Homepages der andern Kolumnisten: www.marvinmueller.ch www.gabrielabucher.ch
www.irenehubschmid.ch Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li
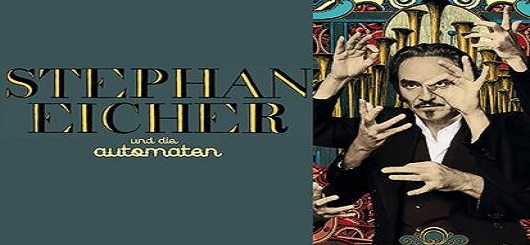 Ich hatte ja an diesem Tag noch kein „déjeuner en paix“, da ich mir dieses natürlich in Chanson Form von Stephan Eicher wünschte, obwohl mir, aufgrund des vorangekündigten Programms eigentlich schon bewusst war, einen Stephan Eicher der anderen Art zu erleben als gewohnt. Eicher gab letzte Woche ein Interview betreffend der Automaten. Dabei erwähnte er, u.a., dass er bei der Firma Decap Gebroeders in Antwerpen recherchiert hatte, eine Firma die führend ist im Bau und Restauration/Unterhalt mechanischer Tanzorgeln, ob pneumatisch, elektronisch oder gemischt betrieben. Da ich mit Roger Mostmans, dem heutigen Betriebsinhaber befreundet bin und über 20 Jahre meine frühere Sammlung antiker Musikautomaten von ihm restaurieren und unterhalten liess (darunter die weltgrösste Mortier Tanzorgel, Baujahr 1923, bestückt mit über 700 Pfeifen auf 19 Register verteilt), war ich logischerweise auf das Ereignis und Resultat dieses musikalischen Experiments besonders vorbereitet und entsprechend eingestimmt und gespannt.
Ich hatte ja an diesem Tag noch kein „déjeuner en paix“, da ich mir dieses natürlich in Chanson Form von Stephan Eicher wünschte, obwohl mir, aufgrund des vorangekündigten Programms eigentlich schon bewusst war, einen Stephan Eicher der anderen Art zu erleben als gewohnt. Eicher gab letzte Woche ein Interview betreffend der Automaten. Dabei erwähnte er, u.a., dass er bei der Firma Decap Gebroeders in Antwerpen recherchiert hatte, eine Firma die führend ist im Bau und Restauration/Unterhalt mechanischer Tanzorgeln, ob pneumatisch, elektronisch oder gemischt betrieben. Da ich mit Roger Mostmans, dem heutigen Betriebsinhaber befreundet bin und über 20 Jahre meine frühere Sammlung antiker Musikautomaten von ihm restaurieren und unterhalten liess (darunter die weltgrösste Mortier Tanzorgel, Baujahr 1923, bestückt mit über 700 Pfeifen auf 19 Register verteilt), war ich logischerweise auf das Ereignis und Resultat dieses musikalischen Experiments besonders vorbereitet und entsprechend eingestimmt und gespannt.
Die Bühne des KKL war bestückt mit den üblichen Sachen, Boxen, Verstärker Scheinwerfer, dazu aber auch eine Art stehendes Xylophon und ein paar andere seltsame Sachen, die sich dann im Verlaufe des Konzertes durch ihr Benehmen (respektive ihre Geräusche) als eben die besagten Automaten outeten. Licht aus und aus dem Dunkel erschien der Protagonist des Abends, heftig bejubelt von seinen Fans im ausverkauften Konzertsaal. Er setzte sich ans Klavier und eröffnete das Konzert mit einem auf berndeutsch vorgetragenen Lied, schnallte sich dann eine Gitarre um und sang ein Chanson auf Französisch, gefolgt von einem Song in englischer Sprache. Etwas ungewöhnlich und akustisch kaum verständlich. Dann bezog er nach und nach auch die Automaten in seine Performance mit ein, gesteuert mittels diversen Fusspedalen, dabei entpuppte sich auch das benutzte Klavier als ein selbstspielendes. So kam etwas Ähnliches wie eine Band zusammen, mit Rhytmusautomaten, Glockenspiel usw. mit Eicher als einziger realer Musiker. Es klang leider alles sehr monoton, war vor allem auf Rhythmus basierend. Irgendwie tönte es nach einer Mischung aus Technorama und Kraftwerk. Das einzige Stück, das richtig kompakt daherkam war die „automatische“ Version von „Déjeuner en paix“ und wurde von den Anwesenden auch frenetisch bejubelt. Eicher referierte relativ viel, gab Anekdoten zum Besten, erläuterte auch den Beginn seiner Passion für die Gitarre und die Musik ganz allgemein. Seine Mutter musste ihn immer mit dem Ruf „Stephan ässe“ aus dem Zimmer locken, wenn er in seine Welt abgetaucht war. So ermunterte er auch das Publikum, ihn mit ebendiesem Ruf zu wecken, falls er sich während der Sets vergessen sollte. Es wurde dann ein paarmal geübt ob das klappt und kaum war das geklärt, ging es munter weiter im Programm. Selbst die bekannteren Kompositionen des Künstlers kamen einem fremd vor in dieser Kombination mit den Automaten, was aber seine Fans keineswegs störte. Das Konzert dauerte dann doch um einiges länger als ursprünglich geplant, verlor sich Eicher doch tatsächlich des Öftern in seinem Raritätenkabinett. Es folgte die Vorstellung seiner „Band“ mit kurzen Erläuterungen, wie er diese zum Spielen gebracht habe. Zurück zu den Wurzeln gings dann bei den Zugaben wie dem unverwüstlichen Campari Soda, auch visuell mit rotem Scheinwerferlicht perfekt in Szene gesetzt, es folgte d`Rosmarie und i und dann verlor er auch noch seine Hemmige ans begeisterte Auditorium, das ihn einfach nicht von der Bühne gehen liess. Deshalb gabs auch noch eine zusätzliche Zugabe in Form eines Solos des elektrischen Klaviers, das mittels Lochkarten gesteuert wurde, sehr zur Verblüffung des Publikums. Ob Eicher seinen Stil in Zukunft auf diesen Stil ausrichten wird wage ich zu bezweifeln, denke eher, es war ein Experiment um sich selber irgendwie auszuloten. Ein aussergewöhnliches Erlebnis war es auf jeden Fall und die Fans feierten Den Künstler und auch sich selbst irgendwie ein bisschen.
Stephan Eicher – Déjeuner en paix (clip officiel)
www.youtube.com/watch?v=S7cP8jGMtAE
Stephan Eicher und die Automaten - Déjeuner en paix
www.youtube.com/watch?v=JmhGt8hWrtY
Text: www.leonardwuest.ch
Fotos: www.allblues.ch
Homepages der andern Kolumnisten: www.marvinmueller.ch www.gabrielabucher.ch
www.irenehubschmid.ch Paul Ott:www.literatur.li