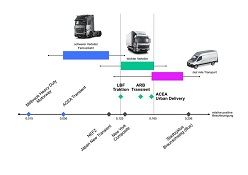CO2-Minderung im leichten Nfz-Verteilerverkehr:generator-elektrischer Antrieb verknüpft Energieeffizienz und Wirtschaft
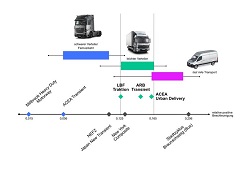
Ab 2025 müssen die in der Europäischen Union neu zugelassenen
Nutzfahrzeuge spezifische Emissionsziele erreichen. Bei zu hohen
Emissionen werden Strafzahlungen pro verkauftem Fahrzeug fällig. Als
Alternative bietet sich, speziell für Fahrzeuge des leichten
Verteilerverkehrs, das im Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlässigkeit LBF patentierte Konzept des generator-elektrischen
Antriebs an. In einem Forschungsprojekt haben wurde ein speziell, für die
Anforderungen des leichten Nfz-Verteilerverkehrs optimierten generator-
elektrischen Antriebsstrang ausgelegt. Näheres vermittelt ein Online-
Workshop des Fraunhofer LBF am 20. Oktober 2021 von 9.00 - 12.00 Uhr.
In Deutschland werden mehr als 70 Prozent des gesamten Güterverkehrs auf
der Straße abgewickelt. Es sind gerade die mittleren Lkw im leichten
Verteilerverkehr, die ihre Nutzlastkapazität unterdurchschnittlich
ausnutzen und deshalb besonders hohe Emissionen je Tonnenkilometer
aufweisen. Batterieelektrische Lkw für diese Transportaufgaben sind
emissionsfrei, allerdings auch schwer und teuer: Im Verteilerverkehr
benötigen sie für eine Fahrstrecke von 200 Kilometern eine
Batteriekapazität von deutlich mehr als 200 Kilowattstunden (kWh), was
einer Zusatzmasse von rund 2,5 Tonnen entspricht und die Fahrzeugkosten
mehr als verdoppelt.
Generator-elektrischer Antrieb für 12-Tonnen-Lkw
Ein wirtschaftlicher und sofort verfügbarer Weg zur emissionseffizienten
Traktionsenergie ist die Nutzung generatorisch produzierter elektrischer
Energie. Dazu dienen effiziente, stationär betriebene Wärmekraftmaschinen
für die mittlere Traktionsleistung sowie elektrische Maschinen zur
Umwandlung der kinetischen Energie bei der Fahrzeugverzögerung. Im Rahmen
des Forschungsprojektes zum »Hocheffizienten Antriebsstrang für
Nutzfahrzeuge unter Berücksichtigung der nationalen Mobilitäts- und
Wasserstoffstrategie« (HANNAe) haben Forschende des Fraunhofer LBF
gemeinsam mit dem Produktbereich »Neue Antriebssysteme« des Fraunhofer ICT
sowie Wissenschaftler*innen von Fraunhofer IMM und ISE einen speziellen,
für die Anforderungen des leichten Nfz-Verteilerverkehrs optimierten
generator-elektrischen Antriebsstrang ausgelegt. Dessen zentrale
Komponenten sind ein für den Betrieb mit biogenen gasförmigen Brennstoffen
ausgelegter 3-Zylinder Motor mit einer konstanten Leistung von 50 kW sowie
ein 32 kWh großer Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-
Hochleistungszellen. Die damit für den Antrieb des generator-elektrischen
Fahrzeugs (GEV) zur Verfügung stehende Leistung und Energie reichen für
typische Tagesfahrstrecken von bis zu 300 Kilometer vollkommen aus und
bedeuten keine Einschränkungen gegenüber konventionellen Diesel-Lkw.
Perspektiven der GEV-Technologie
»Mit der auf die durchschnittliche Leistungsanforderung im leichten
Verteilerverkehr ausgelegten stationären Wärmekraftmaschine sowie dem
besonders kompakten Hochleistungsenergiespeicher für Spitzenleistungen bis
250 kW sind die Komponenten der GEV-Technologie besonders masse- und
kosteneffizient. Aufgrund der deutlich reduzierten Kraftstoffkosten würde
sich der Mehrpreis des generator-elektrischen Lkw innerhalb von zwei
Jahren amortisieren und die CO2-Emissionen deutlich reduziert«, erklärt
Rüdiger Zinke, der das Projekt gemeinsam mit Artur Schönemann am
Fraunhofer LBF betreut.
Wesentlich für die Gesamteffizienz schwerer Straßenfahrzeuge ist die
möglichst vollständige Integration der generatorisch erzeugten
Bremsenergie. »Das wird in unserem Konzept durch besonders leistungsfähige
und alterungsbeständige Zellen gewährleistet, die den Aufbau eines
verhältnismäßig kleinen und kompakten Speichers ermöglichen. Dies ist eine
der besonderen Kompetenzen des Fraunhofer LBF«, so Artur Schönemann.
Der generator-elektrische Antrieb
Fahrzeuge mit generatorelektrischem Antrieb fahren immer elektrisch. Dabei
ist der Elektromotor in Drehmoment und Leistung bedarfsgerecht und optimal
abgestimmt. Typische Kurzstrecken können ausnahmslos mit der Batterie
bewältigt werden.
Das Besondere am generator-elektrischen Powerpack ist die große
Reichweite. Für lange Strecken wird das Batteriesystem ständig im Fahren
geladen. Dazu dient ein monovalenter Gasmotor, der über einen elektrischen
Generator Strom erzeugt, den die Batterie fortlaufend zwischenspeichert.
Der Motor läuft mit konstanter Drehzahl und immer in seinem Wirkungsgrad-
Optimum. Da die Klopffestigkeit von Methangas zudem höher ist als die der
normalen Ottokraftstoffe, verdichtet der Motor stärker. Damit ist die
Energieeffizienz des Gasmotors gegenüber Benzinmotoren deutlich besser.
Im Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen besitzen generator-elektrische
Fahrzeuge eine Wärmequelle, die im Winter den Fahrgastraum wärmt und im
Sommer die Klimaanlage mit Energie versorgt. Die Geräuschentwicklung ist
dezent, da der Motor mit konstanter Drehzahl läuft. Generatorelektrische
Antriebe vereinen so die Reichweiten- und Infrastrukturvorteile von
Verbrennungsmotoren mit den Effizienzvorteilen von Elektroantrieben. Sie
sind für Pkw, Lkw und Nutzfahrzeuge geeignet.
- Aufrufe: 97