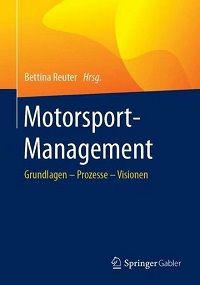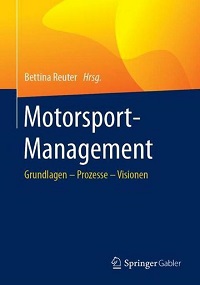Statement: Elektroautos gehen auch bei Rekordhitze nicht in Flammen auf

Sicherheit auch bei hohen Außentemperaturen: Prof. Dr.-Ing. Schilder von
der Frankfurt UAS nimmt Stellung zu aktuellen Medienberichten und verweist
auf Thermomanagement-Systeme für Batteriezellen
Über brennende Elektroautos berichten Medien immer wieder. Angesichts des
heißen Sommers steht die Frage im Raum, ob E-Autos bei diesen
Rekordtemperaturen in Flammen aufgehen könnten. Dies ist Anlass für Prof.
Dr.-Ing. Boris Schilder, Professor für Thermodynamik und Strömungslehre an
der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), mit einigen
Fakten das vermeintlich heiße Thema etwas abzukühlen.
„Lithium-Ionen-Batteriezellen, die Standard sind bei aktuellen
Elektroautos, sollten in einem Temperaturfenster von ca. 15 bis 35 Grad
betrieben und gelagert werden. Bei niedrigeren Temperaturen sinkt die
Leistung, und der elektrische Widerstand der Batterie steigt an. Dadurch
verringert sich die Reichweite des Elektroautos. Bei Temperaturen oberhalb
von 35 Grad reduziert sich dagegen die Lebensdauer von Batterien.
Thermomanagement-Systeme, die kühlen und häufig auch heizen können, sorgen
in Elektroautos dafür, dass die Batterietemperatur im oben genannten
Temperaturfenster gehalten wird“, erläutert der Wissenschaftler, der
selbst solche Thermomanagement-Systeme für die Autoindustrie entwickelt
hat. „Sicherheitskritisch werden erst Batterietemperaturen im Bereich ab
ca. 130 Grad. Bei diesen Temperaturen können Kurzschlüsse und/oder
chemische Reaktionen auftreten und Brände ausgelöst werden.“
Elektroautos geraten laut Schilder trotz sehr hoher Außentemperaturen
nicht in Brand. Die Gründe dafür sind:
1. Das Thermomanagement-System sorgt dafür, dass die Batterietemperatur im
oben genannten Bereich bleibt. Bei einigen Herstellern arbeitet das System
auch bei geparkten Fahrzeugen, hauptsächlich, um die Lebensdauer der
Batterie zu verlängern.
2. Selbst wenn kein Thermomanagement-System die Batterie kühlt, weil
entweder keines vorhanden ist oder es versagt, sorgt eine
Temperaturüberwachung dafür, dass die sich im Betrieb befindende Batterie
abgeschaltet wird und zwar lange, bevor sicherheitskritische Temperaturen
erreicht werden.
3. Ist das E-Auto geparkt, befindet sich die Batterie nicht im Betrieb und
generiert auch keine Abwärme. Selbst bei sehr hohen Außentemperaturen,
Sonneneinstrahlung und ohne aktives Thermomanagement werden innerhalb der
Batterie keine sicherheitskritischen Temperaturen von mehr als 130 Grad
erreicht.
„Elektrofahrzeuge sind relativ sicher, und ich halte einen Brand bei einem
Fahrzeug mit konventionellem Antrieb mit Verbrennungsmotor für
wahrscheinlicher. Aufgrund der Neuheit der Technologie stehen
Elektrofahrzeuge jedoch stärker im Fokus der Berichterstattung, und
einzelne Unfälle fallen daher stärker auf“, nimmt Schilder an. „In der
Regel werden diese Brände jedoch durch Unfälle, fehlerhafte
Batteriezellen, Elektronik- oder Software-Fehler verursacht und nicht
durch hohe Außentemperaturen.“
Auch wenn durch hohe Umgebungstemperaturen die Sicherheit nicht
beeinträchtigt wird, reduzieren sie die Batterielebensdauer und die
Reichweite des Elektroautos. Der Energieverbrauch des Thermomanagement-
Systems und insbesondere der Klimaanlage kann die Reichweite des
Elektroautos bei Umgebungstemperaturen von 40 Grad gegenüber moderaten
Temperaturen von 20 Grad im Extremfall um bis zu ca. 50 Prozent
reduzieren. Leistungslimitierungen aufgrund hoher Umgebungstemperaturen
sind dagegen nicht die Regel, können aber bei Elektroautos auftreten, die
über ein unzureichendes Thermomanagement-System verfügen.
Zur Person:
Prof. Dr.-Ing. Boris Schilder ist Professor für Thermodynamik und
Strömungslehre an der Frankfurt University of Applied Sciences. Einer
seiner Arbeitsschwerpunkte ist das Thermomanagement von Fahrzeugen,
Batterien, Brennstoffzellen und Elektronik. Vor seinem Ruf an die
Frankfurt UAS war Schilder beim Autohersteller Opel u.a. für die
Entwicklung von Thermomanagement-Systemen für Batterien von Elektroautos
zuständig.
- Aufrufe: 378