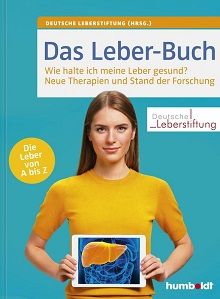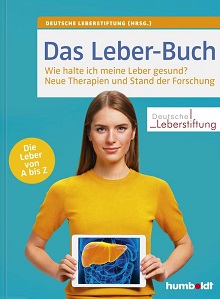Deutscher Lungentag 2021: BZgA sensibilisiert für die Gefahren des Passivrauchens
Anlässlich des Deutschen Lungentags 2021, zu dem in diesem Jahr Aktionen
unter dem Motto „Asthma & Allergien“ am 25. September stattfinden,
sensibilisiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
für die Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen und motiviert Raucherinnen
und Raucher zum Rauchstopp.
Tabakrauch in der Umgebungsluft ist ein sehr gefährlicher
Innenraumschadstoff. In dem Rauch sind unter anderem Giftstoffe wie
Blausäure und Kohlenmonoxid enthalten. Das Passivrauchen birgt
verschiedene Gesundheitsrisiken. So führt eine hohe Passivrauchbelastung
unter anderem zu einem steigenden Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Schlaganfälle. Durch die Giftstoffe im Tabakrauch können bei Kindern
Atemwegsbeschwerden und Asthma hervorgerufen werden.
Michaela Goecke, Leiterin des Referats für Suchtprävention der BZgA,
betont: „Kinder reagieren besonders sensibel auf die Giftstoffe im
Tabakrauch, weil sie in Relation zu ihrem Körpergewicht mehr Luft und
damit auch mehr Giftstoffe einatmen als Erwachsene. Auch baut ihr Körper
Giftstoffe schlechter ab. Etwa jedes siebte Kind im Alter zwischen elf und
17 Jahren hält sich mehrmals pro Woche in verrauchten Räumen auf. Das
Risiko für eine Asthmaerkrankung wird dadurch erhöht. Orte, an denen sich
Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten, sollten im Sinne des
Gesundheitsschutzes konsequent rauchfrei gehalten werden. Das gilt
besonders für die Wohnbereiche und das Auto. Die BZgA unterstützt alle
Raucherinnen und Raucher beim Rauchausstieg. Der Rauchstopp ist die beste
Entscheidung für die eigene Gesundheit und schützt zudem andere vor
Passivrauch.“
Zum Thema Passivrauchen informiert die BZgA in der Broschüre
„Passivrauchen – Informationen zu den Gefahren von Passivrauchen und wie
Sie ihnen aus dem Weg gehen“. Die Broschüre kann kostenfrei bestellt oder
als PDF heruntergeladen werden unter:
https://www.bzga.de/infomateri
/foerderung-des-nichtrauchens-
/passivrauchen-eine-gesundheit
Aufhörwillige Raucherinnen und Raucher unterstützt die BZgA beim
Rauchausstieg mit kostenfreien und qualitätsgesicherten Angeboten:
Online-Ausstiegsprogramm: Infos und Tipps zum Thema Rauchen/Nichtrauchen
mit Forum, Chat, unterstützender täglicher E-Mail und persönlichen
rauchfrei-Lotsinnen und Lotsen unter: https://www.rauchfrei-info.de
Telefonische Beratung zur Rauchentwöhnung unter der kostenlosen Rufnummer
0 800 8 31 31 31 täglich erreichbar, montags bis donnerstags von 10 bis 22
Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr
Informationsbroschüren: „Ja, ich werde rauchfrei“ oder „Rauchfrei in der
Schwangerschaft und nach der Geburt“: Die Broschüren können kostenfrei
bestellt oder direkt heruntergeladen werden unter:
https://www.bzga.de/infomateri
START-Paket zum Nichtrauchen mit der Broschüre „Ja, ich werde rauchfrei“,
einem „Kalender für die ersten 100 Tage“, einem Stressball und anderen
hilfreichen kostenlosen Materialien. Bestellung per E-Mail:
bestellung(at)bzga.de
Die BZgA beteiligt sich mit ihren Rauchstopp-Angeboten auch an der
Bundesinitiative „Rauchfrei leben – Deine Chance“:
https://www.nutzedeinechance.d
Bestellung der kostenlosen BZgA-Materialien unter:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 50819 Köln
Online-Bestellsystem: https://www.bzga.de/infomateri
Fax: 0221/8992257
E-Mail: bestellung(at)bzga.de
- Aufrufe: 59