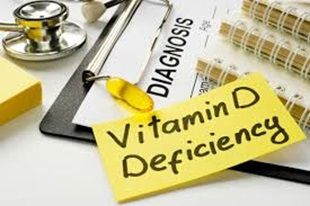Vitaminmangel und Nährstoffdefizit: Mehr als 20 % aller Erwachsenen leiden unter Vitaminmangel!
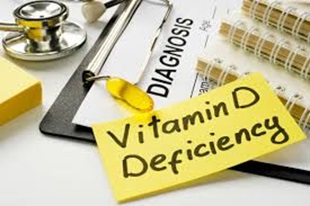
Fast Food, wenig Abwechslung auf dem Speiseplan und nur wenig Obst und Gemüse – immer mehr Erwachsene in Deutschland ernähren sich ungesund. Als Folge der schlechten Ernährung ist eine Unterversorgung mit verschiedenen Vitaminen und Nährstoffen deutlich verbreiteter, als es viele Menschen denken. Denn die meisten Menschen mit einem Nährstoffdefizit bemerken dies häufig erst, wenn sich die Gesundheit schon erheblich verschlechtert hat. Der Bedarf an lebenswichtigen Vitaminen und Nährstoffen hat demnach eine sehr große Bedeutung für die Gesundheit von Körper und Geist.
Viele Menschen fühlen sich ausgelaugt, nur wenig belastbar und schnell gereizt – Grund für anhaltende Müdigkeit, Erschöpfungen und häufiges Unwohlsein sind sehr oft auf eine mangelnde Deckung des Nährstoffbedarfs zurückzuführen. So gibt es eine ganze Reihe von Mangelsymptomen bis hin zu Mangelerkrankungen, welche ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit von Körper und Geist haben können. So kann ein dauerhafter Mangel an verschiedenen Vitaminen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm erhöhen. Ein ausgeglichener Vitaminhaushalt sorgt zudem für ein stabiles Immunsystem. Menschen, welche unter einer Unterversorgung von diversen Nährstoffen und Vitaminen leiden, sind deutlich anfälliger für Bakterien und Viren. Auch die Knochengesundheit wird durch einen Mangel an verschiedenen Vitaminen und Nährstoffen negativ beeinflusst. Dabei ist es heutzutage nicht schwer ausreichend Nährstoffe aufzunehmen. Für eine optimale Vitaminversorgung haben wir Ihnen hier einen Ratgeber zusammengestellt.
Das sind die wichtigsten Vitamine im Überblick
Es gibt 13 essentielle Vitamine für Körper und Geist, auf die man bei der täglichen Ernährung nicht verzichten sollte. Dabei lassen sich Vitamine grundsätzlich in zwei verschiedene Gruppen aufteilen: fettlösliche Vitamine und wasserlösliche Vitamine. Die wichtigsten Vitamine sind Vitamin A, D, E und K, welche zu den fettlöslichen Vitaminen gehören. Die Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 und C sind dagegen wasserlöslich. Ein Großteil dieser Vitamine kann über die Nahrung aufgenommen werden. Einzig das Vitamin D kann erst durch das Sonnenlicht synthetisiert und vom Körper verarbeitet werden. So kann man Sonne tanken mit Vitamin D und damit auch den Calcium-Spiegel anregen. Ein regelmäßiges Sonnenbad ist demnach auch gut für die Gesundheit. Der Mangel an Vitamin D ist in Deutschland weitverbreitet und kann sich im schlimmsten Fall auch auf die Knochenstärke auswirken. Verschiedene Lebensmittel wie Fisch, Milch oder Eier können ebenfalls den Bedarf an Vitamin D decken. Auf diese Weise gelingt es bereit für den Sommer zu sein und den Körper mit ausreichend Vitamin D zu versorgen.
Vitaminmangel vorbeugen und auf eine gesunde Lebensweise achten
Damit das Immunsystem sowohl bereit für den Sommer, als auch für den Winter ist, sollten täglich ausreichend Vitamine und Nährstoffe aufgenommen werden. Durch eine abwechslungsreiche und gesunde Kost aus viel frischem Obst und Gemüse wird es dabei sehr einfach möglich alle essentiellen Vitamine aufzunehmen. Alternativ eignen sich auch Nahrungsergänzungsmittel, welche den Körper ebenfalls alle wichtigen Nährstoffe liefern können. Damit kann mit ganz einfachen Mitteln fit bleiben im Sommer und Winter. Die Deckung des täglichen Vitaminbedarfs lässt sich somit auf ganz unterschiedliche Weise planen. Eine gute Vorsorge mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen ist gerade für die Gesundheit im Alter unerlässlich.
- Aufrufe: 466