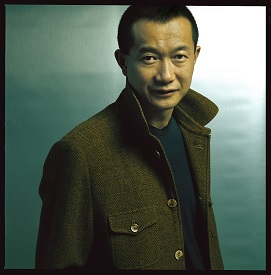Wiedereröffnung des Grand Théâtre de Genève, 12. Februar 2019, Gabriela Bucher – Liechti war für uns vor Ort

Eine ereignisreiche Wiedereröffnung. Zeitgemäße öffentliche Bereiche, 1000 m² mehr Fläche, restaurierte Foyers, neu freigelegte Marmorarbeiten, durchdachte Arbeitsbereiche … durch die Renovierungsarbeiten bekommt das von Jacques-Elisée Goss entworfene und 1879 eröffnete Gebäude eine neue Identität.
Bericht von Gabriela Bucher – Liechti:
Genf und sein neues «Grand Théâtre»

Nach 3 Jahren Bauzeit – plus etwas mehr wegen eines Wasserschadens – wurde am 12. Februar 2019 das Grand Théâtre de Genève wieder eröffnet. Grosse Feierlichkeiten waren nicht angesagt, kein roter Teppich ausgelegt, keine Fanfare aufgeboten. Das hat das Haus aber auch nicht nötig. Es steht stolz, majestätisch und glamourös auf der Place de Neuve und strahlt in seinem neuen/alten Glanz still und stilvoll vor sich hin.
Sorgfalt bis ins kleinste Detail

Olivier Gurtner, Pressechef des Grand Théâtre, erklärte den anwesenden Interessierten bei einem Rundgang durch die diversen Räumlichkeiten welche Arbeiten wie und warum ausgeführt worden sind. Drei Aspekte waren von zentraler Bedeutung bei der Renovation: Mehr Raum, mehr Sicherheit und der Erhalt des historischen Erbes. Nach dem Brand im Jahr 1951 fehlten einerseits die Mittel, um alles wieder so aufzubauen wie vorher, andererseits herrschte damals ein anderer Zeitgeist. Schlicht, modern und nüchtern musste es sein. Decken wurden mit Gips abgedeckt, Fresken übermalen, Parkett mit Teppichen belegt. Jetzt wurden die Kassettendecken wieder hervorgeholt und sorgfältig restauriert, die Teppiche entfernt und das Parkett nach Fotografien wieder hergestellt. Keine Mühen wurden gescheut, um die Räume in alter Pracht aufleben zu lassen. So wurde z.B. in dreitägiger Arbeit ein Spiegel entfernt, nur weil man darunter Fresken vermutete. Spezialisten wurden zugezogen für die diversen Arbeiten. Erinnerungen wurden wach an den Besuch der Baustelle vor ein paar Monaten, wo junge Restauratorinnen in Kleinstarbeit im grossen Foyer mit feinen Pinseln die Goldfarbe rund um die Spiegel nachmalten und halb kauernd halb liegend und mit Hilfe von Lampen die rote Farbe der Wände zuerst sorgfältig abmischten und dann über den Bodenleisten auffrischten.

Ein Raum ist schöner als der nächste. Die relativ kühl gehaltene Eingangshalle mit Marmor, Stuck und den Holztüren mit Messinggriffen geht über ins Atrium, ein wunderbar warmer, farbiger Saal mit der erwähnten Kassettendecke. Auf der «étage noble» kommt man zuerst ins Vorfoyer mit dem Parkettboden und den neuen Schallschutztüren, welche die Motive der Tapete des Foyer Lyrique aufnehmen. Das absolute Prunkstück des Hauses ist das grosse Foyer: Gold soweit das Auge reicht, zartrosa Töne, glitzernde Lüster die von den grossen Spiegeln ins Unendliche vervielfacht werden, wunderschönes Parkett, Deckenfresken, kurz ein Traum, in dem man nicht geht sondern wandelt. Der Ausblick auf die Place de Neuve mit ihrem Verkehr und auf den noch leicht schneebedeckten Salève wirkt irgendwie befremdlich und fast unnatürlich.
Alt und neu stehen sich gegenüber

Zu den neugeschaffenen Räumen, alles in allem 1000m2, davon 800 m2 für Sänger, Choristen, Tänzer und Statisten, gelangt man durch lange, verwinkelte Gänge, wo sich Wände von 1879 und 2019 gegenüberstehen. Da gibt es Proberäume, ein Personalrestaurant und ein Sitzungszimmer in luftiger Höhe. Raffinierte Lösungen bringen Tageslicht auch in die Räume unter der Erde. Fürs leibliche Wohl sind neue Bars entstanden, in zeitgemässem, klarem Design. In der Bar im Untergeschoss steht eine 27 Meter lange, goldene Messingtheke, verkleidet mit rohem Pressbeton, über welche sich drei Bögen spannen. Im dritten Stock erinnert die Sternendecke der Bar des Amphitheaters an die Decke im Zuschauerraum.
Die neue Milchstrasse

Im Zuschauerraum selber wurde wenig gemacht, die Lüftung wurde angepasst und die «voie lactée», die «Milchstrasse» wie die Genfer ihre Theaterdecke nennen, ist mit LED-Lämpchen aufgerüstet und komplett computerisiert worden. Die Galaxie kann sich jetzt um sich selber drehen.
Und so sonnte sich das Haus an seinen Eröffnungstagen majestätisch im wunderbaren Abendlicht und öffnete seine Pforten für die Besucher des «Ring des Nibelungen». Mit gezückten Fotoapparaten wandelten diese staunend und bewundernd durch ihr neues «Grand Théâtre».
Kleine Fotodiashow des restaurierten Theaters von Fabien Bergerat:
Text: www.gabrielabucher.ch Fotos: www.geneveopera.ch
- Aufrufe: 541