COVID-19-Edition des «Wissenschaftsbarometer Schweiz»: Wissenschaft soll sich während Pandemie einbringen
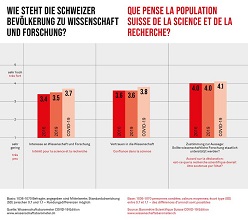
In der COVID-19-Pandemie vertraut die Schweizer Bevölkerung der
Wissenschaft. Sie möchte, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ihre Expertise in Öffentlichkeit und Politik einbringen. Zudem ist sie
mehrheitlich der Meinung, dass politische Entscheidungen zum Umgang mit
der Pandemie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. Das
zeigt die COVID-19 Edition des «Wissenschaftsbarometer Schweiz», die am
Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) der UZH
in Zusammenarbeit mit der Universität Münster durchgeführt wird.
Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung ist
während der Corona-Pandemie gestiegen. So geben 67 Prozent der Schweizer
Wohnbevölkerung an, ihr Vertrauen in die Wissenschaft sei «hoch» oder
«sehr hoch». 2019 und 2016 waren es 56 und 57 Prozent. Auch die Zustimmung
zur staatlichen Förderung von Wissenschaft ist nach wie vor hoch: Während
2019 73 Prozent «stark» oder «sehr stark» zustimmten, sehen dies Ende 2020
weiterhin 74 Prozent der Bevölkerung so. Das grundsätzliche Interesse an
Wissenschaft und Forschung ist ebenfalls gestiegen: 57 Prozent gaben 2019
an, «stark» bis «sehr stark» am Thema interessiert zu sein. Aktuell sind
es 60 Prozent.
«Ich freue ich mich über diesen Vertrauensbeweis gegenüber
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich teilweise sieben Tage
pro Woche für die Eindämmung von COVID-19 engagieren», sagt Claudia
Appenzeller, Generalsekretärin der Akademien der Wissenschaften Schweiz,
welche die Sonderbefragung ermöglicht haben.
Wissenschaftler vor Behörden, Politikern und Journalisten
Wenn es um die Corona-Pandemie geht, vertraut die Schweizer Bevölkerung
den Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So liegen auf
einer Skala von 1 («überhaupt kein Vertrauen») bis 5 («sehr hohes
Vertrauen») Ärzte und medizinisches Personal und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Spitzenwerten von 4.1 und 3.9 deutlich vor Vertretern
von kantonalen Behörden und Bundesämtern (3.3), Politikerinnen und
Politikern (2.7) und Journalistinnen und Journalisten (2.6).
77 Prozent der Bevölkerung stimmen zudem «stark» oder «sehr stark» zu,
dass das Wissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wichtig ist,
um die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz zu verlangsamen.
Entsprechend wünscht sich eine grosse Mehrheit von 72 Prozent («stark»
oder «sehr stark»), dass politische Entscheidungen im Umgang mit der
Pandemie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. «Vertrauen in und
Interesse an Wissenschaft sind in der Schweiz nicht nur anhaltend hoch,
sondern in Corona-Zeiten sogar noch gestiegen», sagt Prof. Mike S.
Schäfer, Universität Zürich, Co-Leiter des Wissenschaftsbarometer Schweiz
und der COVID-19-Edition. 63 Prozent der Bevölkerung wollen, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich aktiv an politischen
Debatten über die Pandemie beteiligen. «Sie sollten dies jedoch mit
geeinter Stimme tun: Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung wissenschaftliche
Kontroversen durchaus für produktiv hält, geben gleichzeitig 65 Prozent
an, sie seien verunsichert, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sich öffentlich widersprechen.»
Die Schweizer Bevölkerung hat Verständnis für Kontroversen innerhalb der
Wissenschaft und bewertet die Kommunikation aus der Wissenschaft positiv.
Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent, «stark» oder «sehr stark»)
findet, dass Kontroversen zwischen Wissenschaftlern hilfreich sind, weil
sie dazu beitragen, dass sich richtige Forschungsergebnisse durchsetzen.
Nur 32 Prozent meinen, dass Wissenschaftler nicht verständlich über Corona
kommunizieren könnten.
Eine Minderheit mit Hang zu kontroversen Ansichten
Die Ergebnisse der COVID-19-Edition des Wissenschaftsbarometers beleuchten
aber auch kritischere Haltungen zur Corona-Pandemie. Dabei zeigt sich,
dass 27 Prozent («stark» oder «sehr stark») finden, dass die Corona-
Pandemie zu einer grösseren Sache gemacht wird, als sie eigentlich ist. 21
Prozent glauben, dass die Zahl der Menschen, die an Corona sterben, von
den Behörden absichtlich übertrieben werde.
Extremere Ansichten sind seltener, aber vorhanden: 16 Prozent glauben,
dass mächtige Leute die Corona-Pandemie geplant hätten. 9 Prozent
bezweifeln, dass es Beweise für die Existenz des neuartigen Coronavirus
gebe. «Auch wenn die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nicht an
Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie glaubt, gibt
es durchaus eine kleine Gruppe von Personen, die die wissenschaftlichen
Informationen zu Corona anzweifeln», erklärt Prof. Julia Metag,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Co-Leiterin des
Wissenschaftsbarometer Schweiz und der COVID-19-Edition.
«Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dies bei ihrer
Kommunikation über die Pandemie berücksichtigen.»
Medienkonsum zu Corona wird vom Fernsehen dominiert
In den Jahren 2016 und 2019 waren Fernsehen und Internet die Orte, an
denen die Schweizer Bevölkerung am häufigsten mit Wissenschaft und
Forschung in Kontakt kam. In Zeiten der Pandemie ist es insbesondere das
Fernsehen, das als Informationsquelle zum Thema Corona genutzt wird.
Danach folgen Gespräche mit Verwandten, Bekannten und Freunden sowie das
Internet als Situationen bzw. Quellen, in denen man dem Thema häufig
begegnet.
Gemischte Gefühle zur Medienberichterstattung zu Corona
Das Wissenschaftsbarometer hat auch erhoben, wie die Schweizer Bevölkerung
die Medienberichterstattung zu Corona bewertet. Sie findet diese
insbesondere «ausführlich», «informativ» und «verständlich». 43 Prozent
der Bevölkerung empfindet die Berichterstattung aber auch als «nervig» und
«übertrieben».
- Aufrufe: 60




